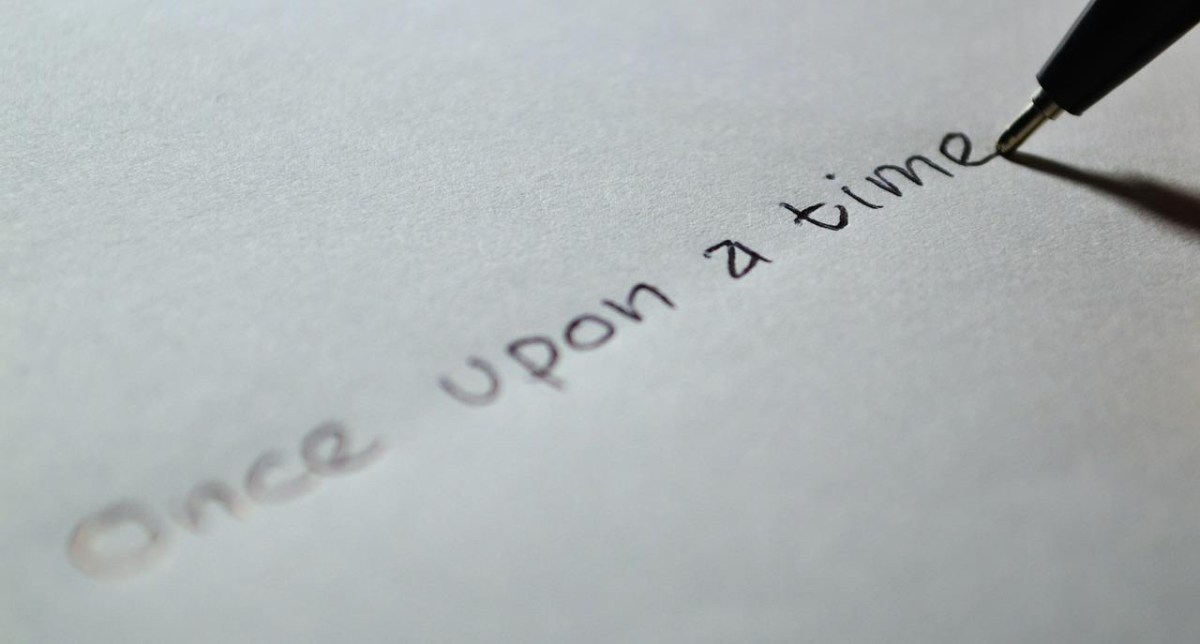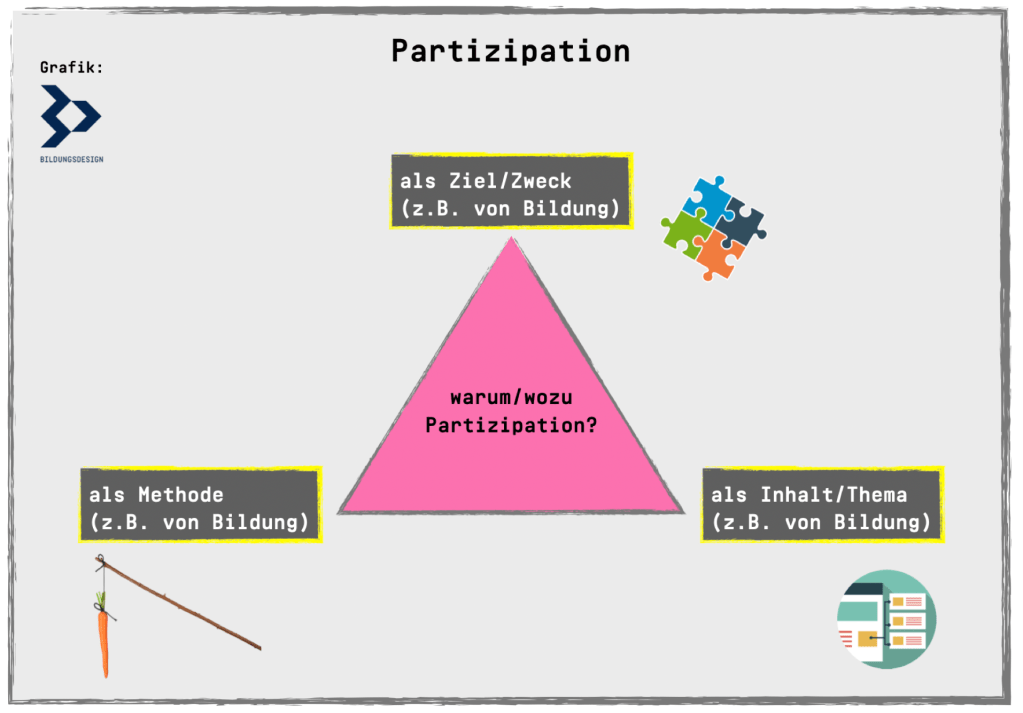Quelle Beitragsfoto
Wenn es um die Aus- und Weiterbildung lehrender Berufe geht, steht im Zentrum, was Schüler*innen, Auszubildende und Studierende wissen & können sollten – und was dementsprechend Lehrende wissen & können sollten, damit sie es vermitteln können. Das wird den Lehrpersonen dann vermittelt. Das alles geschieht im Wissen um das „pädagogische Paradox“, dass Wissen & Kompetenz nicht vermittelt werden können. Das ist lange bekannt.
Sämtliche Varianten von Unterricht – derzeit ein Synonym für Schule – erweisen sich auf dem Hintergrund dieses Paradoxons als ungeeignet für Bildungsarbeit; ebenso wie die Fixierung auf Inhalte und deren Wiedergeben. Dennoch sind diese beide Aspekte bis heute tragende Säulen von Bildungsarbeit – neben Fächerwesen, Benotungskultur, (Jahrgangs-)Klassen und synchroner Präsenz, die für sich und zusammen dem Irrtum erliegen, Wissen und Kompetenz könnten vermittelt werden; und nach wie vor bilden wir Menschen in & zu etwas aus, das noch nie funktioniert hat, und das nie funktionieren wird: Die Vermittlung von Wissen und Kompetenz.
Welches Wissen und welche Kompetenz braucht es stattdessen für Bildungsarbeit – und wie kommt die auf den Weg, da Wissen und Kompetenz nicht vermittelt werden können? Welche Fähigkeiten brauchen dann Bildungsarbeiterinnen und Bildungsarbeiter?
Wir klären Bedürfnisse und Bedarfe
Zuerst realisieren wir erneut oder zum ersten Mal, dass wir im Kontext von Bildung, Schule und Lernen ausnahmslos Menschen begegnen, die – egal in welcher Rolle, Funktion oder Aufgabe sie unterwegs sind – pausenlos am Lernen sind. Der Bubblesprech vom „Lebenslangen Lernen“ meint eben dies. Nun ist Lernen nicht gleich Bildung: Ich kann aufhören mich zu bilden, aber aufhören zu lernen kann ich nicht. Damit mein Lernen nicht im Auswendiglernen und Aneignen von Skills und Tools steckenbleibt, mache ich es immer auch zu Bildungsarbeit.
Wenn wir also etwas anderes wollen als eine Schule, die lediglich „willfähriges, biologisches Material produziert“ und „lebendige Prozesse unterdrückt“, wie der Autoritätsforscher Frank H. Baumann schreibt, dann ist es sinnvoll, dass auch Bildungsarbeit lebenslang bleibt, wenn also alle in Bildungsarbeit Involvierten in eigener Sache Bildungsarbeiter*innen sind und bleiben.
Dann realisieren wir erneut oder zum ersten Mal: Professionelle Bildungsarbeiter*innen (aka „Lehrende“) zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie etwas wissen, was andere Bildungsarbeiter*innen (aka „Lernende“) nicht wissen, sondern dass sie über Fähigkeiten verfügen, mit denen sie Menschen bei der Konstruktion von Wissen und bei der Entwicklung von Kompetenz kompetent begleiten und unterstützen können.
Selbstverständlich ist es schön und gut, wenn Mathematiklehrer*innen sich in Mathematik auskennen. Doch wenn wir nicht mehr mit dem Konzept des/der Mathematiklehrer*in arbeiten (und nicht mehr mit dem Konzept des Mathematikunterrichts bzw. mit dem Fach Mathematik), öffnen sich lernenden und sich bildenden Menschen jene Informations-, Lern- und Bildungsräume, die bisher eingeengt waren auf das, was sie „vor Ort“ als Mathematik erleben. Was gute Mathematik ist, hängt bis heute für alle (!) Menschen davon ab, welche Mathematiklehrer*innen sie hatten – statt umgekehrt.
Die Alternative: Wir orientieren uns in der Bildungsarbeit zuerst an den Bedürfnissen jener Menschen („auf der anderen Seite des Pults“), die von professionellen Bildungsarbeiter*innen begleitet werden – ohne dabei die Bedürfnisse dieser Bildungsarbeiter*innen („Lehrpersonen“) auszublenden, zu vernachlässigen oder in Konkurrenz zu setzen.
Im Gegenteil: Wir fokussieren und klären die Bedürfnisse aller in Bildungsarbeit Involvierten. Warum? Weil die Arbeit an und mit Bedürfnissen Bildungsarbeit ist, wie uns Protagonist*innen in entsprechenden Disziplinen aufgezeigt haben (etwa Ruth C. Cohn und Arno Gruen).
Erste Konsequenz: Bedürfnisse & Bedarfe unübersehbar machen
Deshalb institutionalisieren wir den als eher mühsam erlebten und bis heute oft vermiedenen bzw. diffamierenden „Diskurs“ über Bedürfnisse lernender und sich bildender Menschen. Das ist ein im gegenwärtigen Bildungsbetrieb sträflich vernachlässigtes Anliegen.

Zu diesem Zweck machen wir einerseits diese Bedürfnisse sichtbar. Nicht einmal (1x), auch nicht in Form einer didaktischen Analyse, auch nicht bezogen auf die Vermittlung von Wissen und Kompetenz, die gar nicht möglich ist (was wir lange wissen), sondern, ich wiederhole mich gerne, weil die Arbeit an und mit Bedürfnissen Bildungsarbeit ist.
Wir machen auch kein Fach, kein Unterrichts- und kein Projektthema draus, weil wir damit den Versuch starten würden, Wissen über „Bedürfnisse und Kompetenz im Umgang mit ihnen“ zu vermitteln, was gar nicht geht, wie längst bewiesen ist.
Stattdessen tragen wir gemeinsam Sorge, dass alle an Bildungsarbeit Beteiligten immer besser in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu artikulieren, solche ihrer Mitmenschen in nah und fern zu realisieren, wertzuschätzen und immer wieder neu in Beziehung zu setzen. Sie weder zu ignorieren noch abzuwerten. Wir machen Bedürfnisse unübersehbar. Das tun wir transdisziplinär. So gelingt es uns, die faszinierende Fülle an Wissen & Erfahrung, die wir dazu heute schon haben, im Sinne sich bildender Menschen zu nutzen – für meine Befähigung als Bildungsarbeiter*in, ob ich nun in herkömmlicher Lesart „LehrendeR“ oder „LernendeR“ bin.
Welche Bildungsarbeit braucht die Lebens- und Arbeitswelt?
Zugleich orientieren wir uns in der Entwicklung des neuen Berufs des und der Bildungsarbeiter*in an den gesellschaftlichen und ökononomischen Bedarfen einer sich in einem tiefgreifenden Wandel befindlichen Lebens- und Arbeitswelt. Wir machen auch diese Bedarfe unübersehbar – das ist heute ein wesentlicher Teil von Bildungsarbeit – und gestalten sie so offen wie möglich. Wir engen sie nicht länger ein auf das, was in Bildungsplänen festgehalten ist, denn die sind nur eine Momentaufnahme, ein mühsam erarbeiteter Kompromiss aus dem, was von den Herausforderungen, in denen wir heute stehen, noch nichts wusste.
Bildungsarbeit bedarf heute eines komplett anders aufgestellten Wissensmanagements als über Moodle und Bildungspläne. Glücklicherweise können wir über die Alternativen mehr und anderes wissen als je zuvor. Die Ressourcen liegen uns mit dem Internet zu Füssen – und auch hier gilt es als erstes dem Versuch Einhalt zu gebieten, den Umgang mit diesen Ressourcen irgendwie irgendwem zu vermitteln – und ihn stattdessen zu lernen.
Ein neuer Beruf braucht eine neue Ausbildung
Zugleich klären und entscheiden wir, wie Ausbildungsinstitutionen und -prozesse für Bildungsarbeiter*innen gestaltet sind, sodass Institutionen & Bildungsarbeiter*innen die benötigten Fähigkeiten auf dem Plan & Schirm haben – und zwar 24/7. Die aktuelle Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern – ein aussterbender Beruf – muss zu diesem Zweck nicht auf den Prüfstand. Wir erfinden sie komplett neu. Wir entwickeln einen neuen Beruf und einen neuen Weg hinein, der mit den alten Funktionen, Rollen und Aufgaben nichts mehr zu tun hat.
Ein wichtiger Aspekt dieser Entwicklungsarbeit ist die Auseinandersetzung mit den fundamentalen Veränderungen und Neuerungen der Berufswelten: Wie verändern sich Berufe? Was bedeutet es heute im Unterschied zu anderen Zeiten, einen Beruf zu erlernen, einen zu haben, ihn auszuüben? Die zahlreichen Szenarien, Alternativen und Möglichkeiten, die es da heute gibt, spiegeln sich im neu zu entwickelnden Beruf der Bildungsarbeiterin und des Bildungsarbeiters ganz selbstverständlich: Wer sich als LernendeR Gedanken macht über seine bzw. ihre zu entwickelnde Berufsbiografie, findet im Gegenüber einer Bildungsarbeiterin ein Beispiel für diese Vielfalt, im Unterschied zum heute noch weit verbreiteten „einmal Lehrer immer Lehrer“.
Eine Bildungsarbeiterin wirkt dann nicht länger „vorbildlich“ bei meiner Suche nach Antworten auf die Frage, was ich einmal werden will (oder nicht), sondern eher auf die Frage, wie ich etwas werden und sein möchte.
Diese Entwicklungsarbeit hin zum neuen Beruf des/der Bildungsarbeiter*in ist also bereits der erste Schritt im neuen Konzept und im neuen Beruf. Sie bereitet das nicht vor. Es gibt keine „Vorbereitung“ mehr, keine Vermittlung von Zukunftskompetenz, nur das reale Leben & Lernen und unsere Reflexion auf beides.
Neu ist damit auch: Was Studierende lernen, die einen Bildungsberuf anstreben, korreliert nicht mit dem, was „später einmal“ die Bedingungen sind, unter denen sie dann Bildungsarbeit machen, weil sich die Bedingungen von Bildungsarbeit pausenlos verändern. Bildungsarbeit ist immer im „Hier & Jetzt“, und sie bringt die Bedingungen, unter denen sie zur Sache geht, hervor.

Es gibt kein „vor und nach“ der Ausbildung, weil beide auf eine professionelle Weise zirkulär funktionieren – nicht in dem Sinn von „zirkulär“, wie sie im Bildungssystem funktionieren:

Nicht zirkulär also im Sinne eines „mehr vom Selben“, sondern „mehr von Unterschiedlichem“: Lern-Fortschritt als Zunehmen und Unterstützen von Unterschiedlichkeit, wie Remo Largo nicht müde wurde einzufordern:
Wie finden sich bereits berufstätige Lehrer*innen darin zurecht?
Flankierend entwickeln wir attraktive, hochwertige Angebote für aktive Lehrerinnen und Lehrer, in denen sie sich fit machen für diese riesigen Herausforderungen, indem sie lernen (!), sich in ihnen souverän zu bewegen. Wir lassen dabei jedem und jeder völlig und vorbehaltlos frei, ob sie diese Angebote annehmen, oder ob und wie sie sich anderweitig für die neuen Herausforderungen qualifizieren, oder ob sie (als ein mögliches Ergebnis dieser Entwicklungsarbeit) auf einen anderen Beruf umsteigen. Auch dabei unterstützen wir nach Kräften.
Was wir dabei ganz sicher nicht tun: ihnen irgendetwas vermitteln.
Klammern wir also die Diskussionen darüber, „was junge Menschen heute können und wissen müssen“, für einen Moment ein (nicht aus sondern ein, denn da wissen wir ja schon recht viel drüber) und klären ganz grundsätzlich, wie der neue Beruf des Bildungsarbeiters und der Bildungsarbeiterin aussieht: welche Haltungen er bei denen voraussetzt, die ihn praktizieren (wollen) – deren Reflexion ein wesentlicher Teil der gesamten Berufsbiografie ist.
Wir laden über alle kulturellen Bereiche hinweg aktiv dazu ein, diesen Prozess auf Augenhöhe mitzugestalten. Als ein zivilgesellschaftliches Projekt.

Damit werden wir drei zentralen Anliegen gerecht
Erstens entwickeln wir einen Beruf, der für jene eine anziehende und nachhaltige berufliche Möglichkeit darstellt, die wir gerne für diese Arbeit hätten, und die wir brauchen. Wir, die wir uns lebenslang bilden. Ich hätte gerne Bildungsarbeiter*innen, die sich als Partner*innen begreifen, die an (ihrer eigenen und jedweder) Entwicklung interessiert sind, an Entfaltung von Potenzial, die grundlos neugierig sind, lernbegierig, expeditionsfreudig.
Wir tun also nicht länger etwas „gegen Lehrermangel“, um den Lehrerberuf (wieder) attraktiv zu machen, sondern wir entwickeln schleunigst einen neuen, attraktiven Beruf – und wir tun es nicht in den (digitalen) Hinterzimmern von Schulverwaltungen und Pädagogischen Hochschulen, sondern dort, wo Menschen gemeinsam Bildungsarbeit machen, denn Bildungsarbeit bringt die Bedingungen, unter denen sie sich ereignet, jeweils mit.
Zweitens eröffnen wir Menschen, die aktiv im Lehrberuf stehen, Möglichkeiten, sich neu zu entscheiden und zu professionalisieren; und zwar für das und auf das hin, was ihnen entspricht. Sie finden Unterstützung, die an keine Bedingungen oder Ergebnisse geknüpft ist – analog zu einer Hochform des BGE, wie sie hier reflektiert wird.
Drittens entwickeln wir dadurch kontinuierlich eine Bildungsarbeit auf der Höhe der Zeit, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gerecht wird. Wir bereiten ab jetzt nicht mehr „durch die Ausbildung auf Bildungsarbeit vor“, sondern praktizieren durchgehend Bildungsarbeit: Wir entwickeln uns an jedem Punkt unserer Bildungsbiografien und Lebensgeschichten weiter und unterstützen und begleiten uns gegenseitig in und mit all unserem Entwicklungspotenzial, unseren Bedürfnissen, Bedarfen und Sehnsüchten.