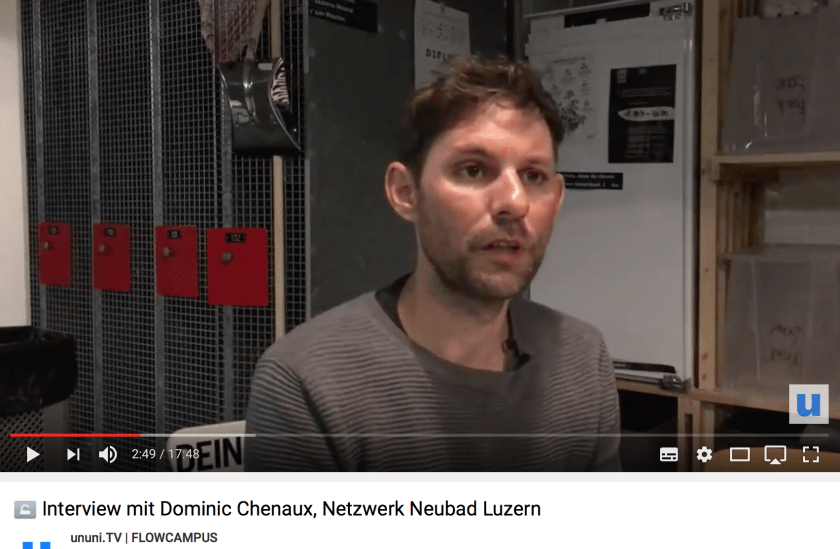Quelle: @bildungsdesign über digitale Demokratie-Plattformen #FutureHubs #D2030 @FuturICT
Beiträge
Wer oder was ist gebildet? Eine Erzählung

Wir stehen gerade in einer radikalen Umwälzung, wenn es um die Beantwortung der Frage geht, wer wir sind. Bis vor wenigen Jahren war das durch „große Erzählungen“ wasserdicht geklärt: Wer wir sind und was wir hier sollen. Die Religionen waren da über Jahrtausende hinweg federführend. Sie lieferten den Stoff für den Sinn des Lebens. Gegenwärtig verlieren diese Erzählungen immer mehr an Strahlkraft und Wirkung. Die übrig Gebliebenen radikalisieren sich im Moment, bevor sie dann vollends verschwinden werden. In Zukunft bildet dann nicht mehr das, was erzählt wird, einen Sinn für uns. Sinn erleben wir vielmehr dadurch, dass wir überhaupt miteinander ins Erzählen und Zuhören kommen – und darin bleiben. Das ist die neue, kulturelle Herausforderung.
Was hat das mit Bildung zu tun? Wann bin ich denn „gebildet“? Das Wort steht im Passiv. Es erweckt den Eindruck, dass jemand, eine Schule, ein Bildungssystem etwas mit mir macht. Das erleide ich dann. Mehr oder weniger passiv. Bis zum letzten Schultag. Erst werde ich gebildet, dann bin ich es. So die traditionelle „Erzählung“. So das Bildungsnarrativ, das bis heute ganz selbstverständlich gilt. Peter Bieri hingegen meint, bilden könne „sich jeder nur selbst“[1]. Dann wäre Bildung Eigeninitiative. Was auch immer andere dazu beitragen – bilden kann ich mich nur selbst.
Was aber tun dann all jene, die sich institutionell für unsere Bildung zuständig erklären? Mit Martin Walser gesprochen nichts Gutes: „Es scheint beim Erzogenwerden darauf anzukommen, sich auch vor sich selbst zu verstellen. … Man soll sich selbst undeutlich sein. Dann widerspricht man nicht, wenn sie einem sagen, wer man ist.“[2]
Die Bildung ist ein normativ aufgeladenes Geschäft. Und in den ersten beiden Lebensjahrzehnten nicht unterschieden von der Erziehung. Das liegt wohl am Eifer des Gefechts, in dessen Verlauf die Bildung Normen transportiert bis zum Anschlag. Weil die „Erzählung“ dahinter so gestrickt ist: Bildung gibt Menschen- und Weltbilder an die nächste Generation weiter. Komme, was da wolle.
Die längste Zeit war unsere Bildungswelt christlich geprägt. Lange stand die christliche Tradition exklusiv für die Bewahrung exklusiver Erzählungen und für einen durch das Erzählte bestimmten Sinn. Damit alles an seinem Platz bleibt. Ganz wunderbar skizziert wird das in dem Schweizer Kinofilm „Die göttliche Ordnung“, der die letzten Tage vor der Einführung des Frauenstimmrechtes im Jahr 1971 nacherzählt. Acht Jahre danach erscheint François Lyotards Werk „La condition postmoderne“. Es diagnostiziert das Ende der grossen Erzählungen. Seither kann einen schon mal das Gefühl beschleichen, das wir ein wenig durcheinander gekommen sind.
Der Einfluss der Digitalisierung
Denn seit jenen Tagen wird die normative Funktion von Narrativen brüchig – ohne dass das Narrativ als solches überflüssig wäre. Neu ist: Im Kontext der Digitalisierung verschärft sich das Phänomen der Vielstimmigkeit ungemein. Der Kampf geht um Aufmerksamkeit, nicht um Deutung. Nicht was gebrüllt wird, ist entscheidend, sondern wie laut. Konsens gibt es da allenfalls noch als Choral – auch als einen der eingebundenen Misstöne: Flashmob.
Verstärkt (nicht hervorgerufen) wird diese Entwicklung durch die Digitalisierung der Kommunikation, der Kulturen, der Märkte. Narrative werden definitiv vielstimmig und verändern sich nur noch als Chor. Dabei greifen sie nicht mehr auf eine Partitur („normative Begründungen“) zurück, sondern komponieren sich singend – also erzählend. Halten wir das aus?
Der Sinn eines Narratives entsteht und vergeht heutzutage beim Erzählen. Er ist dem Gespräch nicht mehr vorgelagert. Er schöpft sich aus dem Hier und Jetzt, im spontanen Gestalten von Gemeinschaft – zu welchen Zwecken auch immer: um sich zu bilden, um Arbeit zu organisieren, um eine Gesellschaft zu sein. Die sich treffen, bilden sich für diesen Moment und ver-gehen dann wieder. Sie bringen ihre Narrative vielleicht mit, aber sie fordern sie nicht zwingend ein, weil der Sinn im Erzählen entsteht, nicht durch Erzähltes.
Das neue Paradigma: Erzählen schlägt Erzähltes
Was bedeutet das für die Bildungsarbeit? Es bedeutet: „Gemeinsames Erzählen bildet“. Erzählen hat noch immer die Funktion der Selbstvergewisserung. Aber jetzt nicht mehr, indem ich auf Erzähltes fokussiere, sondern auf das Erzählen selbst. Ob dieses Phänomen neu ist, weiss ich nicht, aber im Moment entwickelt es sich zu einem Paradigma. Zu einem Narrativ. Zu einer Art „Digital Derrida“.
Das Neue am neuen Narrativ ist: Was als Erzählung Sinn hat, entscheidet allein der Kontext – nicht bildet sich der Kontext durch das Erzählte. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und wir sind mittendrin. „Sinn“ ist nicht mehr Teil einer Lieferung (als Buch, Unterricht, Vortrag oder Seminar), sondern Ergebnis eines kollaborativen Produktionsprozesses. Erzählgemeinschaften (Familien, Vereine, Seilschaften, Netzwerke) bilden sich nicht mehr um traditionelle Narrative herum. Sie bilden selber welche und verwerfen sie wieder. Das begegnet mir in digitalen Kulturen wie Makerspace, Coworking, Kollaboration und Blockchain andauernd.
Sich aus Erzähltem freischzuwimmen wird leichter
Das Gute daran ist: Ich werde als Individuum nicht auf mich selbst zurückgeworfen oder zum einsamen Sinnkonstruktivisten. Schon gar nicht „wegen dieser Digitalisierung“. Vielmehr arbeiten wir durch unser Erzählen und Zuhören fortwährend an unserer persönlichen Identität wie auch an der unserer Community. In diesem Prozess verliert meine (Herkunfts-)Erzählung womöglich den Anspruch von Exklusivität, auch mir selbst gegenüber. Aber das kann ja auch eine ungeheure Befreiung sein. Nicht nur für die Frauen im Kampf um Gleichberechtigung in den Siebzigern. Nicht nur für schwule und lesbische Musliminnen und Muslime. Wenn Ursprungserzählungen ihre Deutungsmacht verlieren, gewinne ich ganz grundsätzlich auch an Freiheit: im Erzählen, im Zuhören, im gemeinsamen Produzieren von Sinn. Nicht auszudenken, was das im Schmelztiegel der Kulturen an Chancen bedeutet.
Sich aus Erzähltem frei zu schwimmen führt in immer neue Narrative. Nicht weil das Erzählte emanzipatorisch wirkt, sondern weil das Erzählen befreit. Handfest und heilsam. Durch die Digitalisierung eröffnen sich hier ganz neue Räume und Netzwerke. Gelegenheiten der Befreiung und der Verbindlichkeit auf Augenhöhe – letztlich der Bildung von Gemeinschaft. Nur eben ganz anders, als wir es gewohnt sind. Aber wem erzähle ich das…
[1] ZEITmagazin LEBEN, 02.08.2007 Nr. 32
[2] M. Walser/A. Ficus (1982): Heimatlob. Insel Taschenbuch, S. 34ff.
Der digitale Raum: Fremd und gefährlich?

Ich vermute, dass noch immer sehr viele Menschen dem Internet skeptisch gegenüber stehen, weil sie es als einen Raum erleben, in dem Dinge passieren, denen sie nicht über den Weg trauen. Sie sehen das Netz als einen Raum, in dem man sich verirren kann, in dem man ausgenutzt, ausgespäht und missbraucht wird – abgezockt und um die Privatsphäre betrogen. Es ist nicht nur ein Raum, in dem ich mich zu schützen habe, sondern einer, vor dem ich auf der Hut sein muss.
Anja C. Wagner hat in einer kleinen Netzumfrage Vermutungen eingefangen, warum in Deutschland und in der Schweiz vor allem Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen Vorbehalte gegen ein Engagement in Sozialen Medien hegen.
Im Ergebnis stellt sich heraus: Es fehlt die Auseinandersetzung und deshalb die Erfahrung. Die Angst vor dem Kontrollverlust ist groß. Außerdem besteht noch kein echter Handlungsdruck – und nicht zuletzt ist es auch eine Statusfrage: Was erwartet mich, wenn ich in den Sozialen Medien auf Augenhöhe mit Menschen interagiere, die nicht meiner „Eliteblase“ entstammen?
Die Digitalisierung stellt unsere Beziehungen zum Raum auf den Kopf
Die hartnäckigen Gründe liegen noch tiefer: Für viele ist das Netz ein Raum, in dem sich vor allem Beobachter tummeln und Beobachtete: Lurkers meet Lurkers. Dazwischen scheint es nur wenig zu geben. Echte Interaktion etwa, oder Zusammenarbeit. Diese beiden verorten wir nach wie vor lieber im Meatspace, nicht im Cyberspace. Das Netz ist das Meer, aus dem wir etwas fischen, um es dann im richtigen Leben, ganz analog, zu gebrauchen. Manchmal verabreden wir uns auch im Netz, aber „treffen“ werden wir uns dann doch lieber in der so genannten Realität.
Auch sind wir es gewohnt, dass Räume, die wir betreten, vorher da sind – sonst könnten wir ja nicht hinein. Im Netz ist das anders. Da entsteht der Raum dadurch, dass wir ihn öffnen. Das könnte eine große Chance sein für Kollaboration. Das wird aber so gut wie nicht genutzt, denn digitale Räume sind zuerst einmal nicht strukturiert oder eingerichtet. Wir sind aber groß geworden mit und in Räumen, in denen alles seinen Platz hat. An der Art seiner Einrichtung erkennen wir den Raum und seinen Zweck. Vor allem jene Räume, in denen wir lernen und arbeiten. Da herrscht Ordnung. Wir lernen früh, dass Räume gestaltet sind, wenn wir sie betreten. Und daran erkennen wir, wo wir sind. Nicht so im Cyberspace. Da sind wir zur Gestaltung herausgefordert. Wir haben alle Möglichkeiten, und das sind zu viele.
Schlachthof oder Tanzsaal? Der Cyberspace ist beides zugleich
Denn der digitale Raum erhält seinen Zweck dadurch, dass wir eintreten. Er bekommt seine Identität dadurch, dass wir ihn betreten – in dem Moment, in dem wir das tun. Du, ich und die anderen. Der digitale Raum entsteht durch unsere Anwesenheit in ihm. Und er verliert sich in dem Moment, in dem wir ihn wieder verlassen. Strange, isn’t it?
Im Unterschied zu den meisten materiellen Räumen ist der Cyberspace nicht vorgespurt. Der materielle Raum hat und verfolgt meist nur einen bis eineinhalb Zwecke. Er ist entweder Schlachthof oder Tanzsaal. Deswegen sind die materiellen Räume auch so zahlreich: weil sie durch ihre Nutzung eingeschränkt sind. Deshalb braucht es viele davon. Nicht so im Cyberspace. Der definiert sich durch das, was diejenigen in ihm veranstalten, die ihn öffnen und wieder schließen. Die Digitalisierung macht uns bewusst, dass ein Raum nur das ist, was wir darin tun. Auch wenn wir ihn noch so zumüllen mit Materie.
Das ist genial: Je weniger ein Raum durch seine Nutzung vorherbestimmt ist, um so mehr kann in ihm entstehen. Er bekommt erst durch die Art und Weise seiner Nutzung und Inbesitznahme einen Sinn. Er entsteht durch die Artikulierung der Anliegen derer, die ihn betreten und dadurch „konstituieren“, also bilden. Das steckt hinter den neuen Buzzwords vom Coworking-Space, vom Colearning- und vom Makerspace. Die Gestalter definieren den Raum nicht nur, sie bilden ihn gemeinsam – und sie lösen ihn wieder auf. Deshalb sind Lern- und Arbeitsräume in Zukunft immer weniger (vorher-)bestimmt – und genau deshalb wird so Vieles in ihnen möglich.
Der digitale Raum ist nicht virtuell. Er ist, was wir aus ihm machen.
Der virtuelle Raum, wie er uns immer wieder durch die Träger*innen klobiger VR-Brillen und die Propheten aus der virtuellen Realität vor Augen geführt wird, der ist – genau wie der Raum des analogen Zeitalters völlig durchgestylt, durchdesignt und gestaltet. Er ist programmiert. Davon hängt ab, was in ihm passiert. In diesem virtuellen Raum werden wir pausenlos geführt. Was wir darin entdecken ist identisch mit dem, was zu entdecken vorgesehen und vorgegeben (und programmiert) ist. Wir suchen die Ostereier.
Der digitale Raum, der ein kollaborativer ist, hat mit dem Raum der „VR“ nichts zu tun. Wenn es im digitalen Raum überhaupt Prinzipien gibt, dann z.B. das der Serendipity: Ein kreatives, nicht vorhersehbares und kollaboratives Entdecken und Kombinieren. Design von Feinsten. Im digitalen Raum werden keine versteckten Ostereier entdeckt wie im Raum der VR. Es geht nicht ums Finden sondern ums Entdecken. Um Expedition.
Die nächste Stufe: Denkräume neu erfinden und gestalten
Diesen Paradigmenwechsel kriegen wir aber nur hin, wenn wir auch mit unserem Denken in neue Räume vorstoßen – indem wir sie betreten. Miteinander. Statt dass wir uns konsequent im Kreis bewegen und immer wieder durch dieselben Denkräume mäandern. Klar, das gibt Sicherheit, weil „da drin“ alles immer so ist, wie es war. Das Bedürfnis ist groß, immer und immer wieder an denselben Begriffen, Überzeugungen, Abläufen, Hierarchien, Mindsets, Menschen- und Weltbildern vorbei zu kommen.
Daraus entsteht aber nur eine Zukunft, die ein „mehr Desselben“ ist. Die Metapher vom „digitalen Raum“ hingegen erlaubt mir, den gemeinsamen Denkraum frei zu gestalten und weiterzuentwickeln. Nie war es einfacher aber auch dringlicher, unser Denken für das Entdecken echter Alternativen einzusetzen. Es ist das Gebot der Stunde.
Über eine Bildung ohne Instruktionen und moralischen Drill
Vor wenigen Tagen hat Gunnar Sohn mich interviewt zu meinem aktuellen Buch „Die Moral ist tot. Es lebe die Ethik.“ Es wurde ein spannendes Gespräch über Möglichkeiten und Chancen einer ethischen Bildungsarbeit auf Augenhöhe – jenseits dessen, was wir uns bis heute an Schule gewohnt sind – und was nirgendwo hin mehr führt. Eine Kurzversion des Interviews gibt es hier:
Gunnar Sohn ist ein äußerst agiler und erfolgreicher deutscher Wirtschaftspublizist und Medienberater. Er vernetzt digitale Akteure, die an einer kollaborativen Gestaltung einer neuen Netzökonomie und -soziologie interessiert sind.

Für mich war diese Arbeit mit ihm denn auch ein exzellentes Lehrstück über digitale Kommunikation. Ich bin begeistert über die Art, wie er sich in den Sozialen Medien bewegt, wie er Themen platziert, Menschen einbezieht und vernetzt. Das macht nicht nur richtig Spaß. Es beeindruckt mich und zeigt mir, in welche Richtung wir uns bewegen werden, wenn wir erfolgreich sei möchten und zugleich gute Sachen auf den Weg bringen.
Die Langversion des Interviews gibt es hier.
Ethische Bildungsarbeit jenseits der Stoff-Bulimie #Autorengespräch
Interview mit Dominic Chenaux vom Netzwerk Neubad in Luzern
Derzeit nehme ich an einem MOOC teil mit dem Namen Leuchtfeuer 4.0. Worum es da geht, erfahrt Ihr unter anderem hier.
An einem MOOC teilnehmen heisst in unserem Fall: ihn mit gestalten. Also schreibe ich alle zwei Tage eine Kolumne auf linkedin über das, was gerade so passiert in den Foren des MOOC – und welche Themen gerade dran sind. Zudem durfte ich für zwei Tage mit einer Kollegin zusammen die Themenpatenschaft übernehmen – und vor zwei Tagen ein Interview mit Dominic vom Netzwerk Neubad Luzern führen.
Im Interview stellt er das Projekt vor und hat mich völlig begeistert von der Idee, die hinter all dem steckt. Aber hört selber rein:
Muss die Bildung die Welt verbessern?
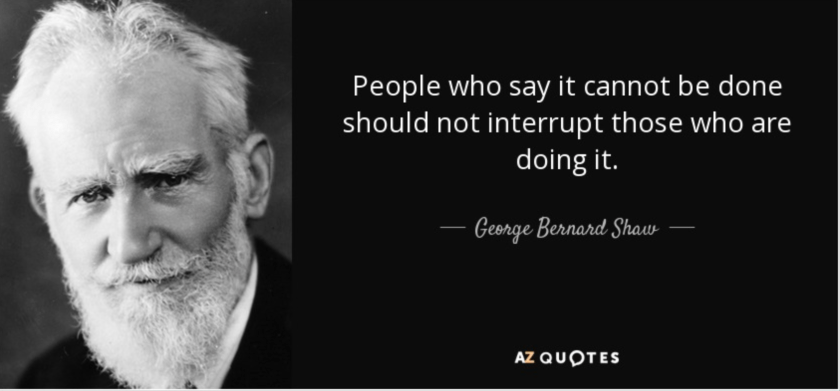
Die schlimmsten Aufforderungen sind die, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind. Wir nehmen sie ernst, tun unser Bestes – und floppen. Im Fachjargon reden wir von Double Bind: „Sei spontan!“, oder „Überrasch mich mal!“ In einer einzigen Nachricht stecken zwei widersprüchliche Botschaften.
Auch der Auftrag an die Bildung, die Welt zu verbessern, ist so eine Aufforderung. Wenn sie nämlich damit anfängt, löst sie umgehend Gegenreaktionen aus. Warum? Weil Verbesserung immer mit Veränderung zu tun hat. Und die tut weh. Vom Mathematiker Georg C. Lichtenberg stammt der Spruch dazu: „Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Aber wenn es besser werden soll, muss es anders werden.“
Und es gibt noch einen Grund: Bildung und ihre Einrichtungen (z.B. Schulen und Hochschulen) haben bis heute den Auftrag, Gesellschaft zu reproduzieren, nicht sie zu verändern. Letzteres macht höchstens die Forschung. Die so genannte „Lehre“ bildet Bestehendes ab und gibt es an die nächste Generation weiter: Strukturen, Hierarchien, Welt- und Menschenbilder. Und jede Menge Informationen, die sie als Wissen ausgibt wie die Kantine das Essen.
Der traditionelle Schulbetrieb ist ein Überbleibsel der Industrialisierung, das sich in unseren Kulturen eingenistet hat. Er dient vor allem dem Erhalt eines Gesellschafts- und Menschenbildes, das bis heute eine Mischung aus Taylorismus, preussischer Diszipingläubigkeit und einem Rest protestantischer Wirtschaftsethik im Windschatten eines Max Weber ist.
Wer der Bildung jetzt den Auftrag gibt, die Welt zu verbessern, sagt zwischen den Zeilen: „Wasch mich, aber mach mich nicht nass.“ Unsere herkömmliche Bildung kann die Welt gar nicht verbessern, weil und solange sie den Auftrag hat, Bestehendes zu bewahren. Deshalb muss die Gesellschaft erst einmal dafür sorgen, dass die Bildung sich verändert. Damit sind wir gemeint. Du und ich.
Nicht die Bildung verändert die Welt – sondern umgekehrt
Das ist aus zwei Gründen nicht so schwierig, wie es klingen mag. Erstens verändert sich die Welt so oder so. Im Moment sogar ganz radikal. Zweitens sind es immer Menschen, die die Welt verändern. Nicht die Systeme. Wirkliche Veränderungen entstehen immer ausserhalb des Bildungssystems. Krass, nicht wahr? Wozu dann Bildungssysteme? Das frag ich mich auch schon länger. Denn um Lesenschreibenrechnen zu lernen, braucht es sie ja auch nicht. Da ist längst erwiesen. Hinzu kommt: Der technische und der menschliche Fortschritt auf dieser Welt waren und sind keine direkte Folge schulischer Bildungskultur. Es waren ja nicht die Lehrer von Steve Jobs, die das iPhone erfunden haben. Die Orte, an denen solche Innovationen entstehen, haben so wenig mit Schule zu tun wie der Mathematikunterricht mit einer dynamischen Entdeckerkultur. Der erstickt sie ja eher im Keim (und redet sich am Ende immer damit raus, dass die Schüler halt zu doof und der Lehrplan zu voll seien). Die Alternative ist längst bekannt. Sie heißt Makerspace.

Digitaler Wandel als positive Herausforderung
Eine Schlussfolgerung daraus könnte lauten: Gerade, weil sich unsere Lebens-und Arbeitswelten derzeit so stark und so schnell verändern wie selten zuvor, geben wir als Gesellschaft der Bildung den Auftrag, ihren eigenen neu zu interpretieren. Lehrende, Schulleitende, Politiktreibende, Verwaltungsfachleute, Führungskräfte, Studierende, Eltern und ihre Kinder tun sich zusammen und legen gemeinsam los. Weil wir begreifen, dass und wie wir uns momentan radikal verändern, interpretieren und gestalten wir den Auftrag von Bildung neu.
Wir werden uns darüber klar, dass Bildung, Gesellschaft und Ökonomie einander nicht gegenüberstehen, sondern im selben Feld spielen. Miteinander und nicht gegeneinander. Ein neuer Auftrag für die Bildung könnte dann lauten: Menschen lebenslang alles zur Verfügung zu stellen, was diese brauchen, um sich zu Weltverbesserern heran zu bilden. Konkret:
- Statt auf Schule zu machen ermöglicht Bildung auf allen Ebenen selbstbestimmtes, selbstverantwortetes, kollaboratives und ko-kreatives, projektorientiertes, Disziplinen übergreifendes, auf Kompetenz und Performanz hin angelegtes Lernen.
- Um das leisten zu können, vernetzt sich Bildung jederzeit kreuz und quer mit diversen Funktionsträgern aus Kultur, Ökonomie und Gesellschaft.
- Sie fokussiert nicht mehr länger auf das isolierte Individuum, sondern versteht Lernen endlich als das sozial-kollaborative Phänomen, das es ist.
- Ganz wichtig: Weil Schule aufgehört hat, aus Menschen Schüler zu machen, weil sich Klassenzimmer und Seminarräume in ihre Bestandteile aufgelöst gelöst haben, organisiert sich das Lernen neu: kreativ, lustvoll, zielgerichtet, moderiert.
- Bewertung, Selektion und Zertifizierung sind endgültig weggefallen. Nicht mehr Defizite stehen im Zentrum, sondern ausschliesslich Ressourcen und Potenziale.
- Bildung bereitet nicht mehr auf Zukünftiges vor, sondern nimmt es mit ihren KlientInnen zusammen konsequent vorweg. Als Institution lernt die Bildung, von der Zukunft her zu denken und zu handeln, wie Lorenzo Tural Osorio das vorschlägt.
Diese Artikel erschien zuerst leicht angepasst in der pädagogischen Fachzeitschrift schulpraxis.
Regionale Bildung 4.0 – Eindrücke des ersten Tages
St dasHeute begann das Projekt „Regionale Bildung 4.0“ und ich freue mich sehr darauf, mit Hilfe dieses Projektes bei den eigenen Überlegungen durch den anstehenden Austausch voranzukommen. Weiterhin habe ich auch die Hoffnung mit eigenen Impulsen etwas der Community zurück geben zu können.
Das Projekt ist in zwei Stufen unterteilt.
- Stufe: ist der Leuchtfeuer 4.0 MOOC. Hierbei handelt es sich um einen zweiwöchigen Online-Kurs, der auf der MOOC Plattform mooin. Dieser MOOC stellt folgende Themen in den Vordergrund:

- Neue Entwicklungen
- Neue Berufe
- Neue Räume
- Öffnungsprozesse
- Motivation & Nutzen
- Finanzen & Organisation
- Stufe: besteht in einer Expedition zu verschiedenen regionalen und digitalen Modellansätzen im ländlichen und städtischen Raum. Was lernt man an Orten wie Makerlabs und CoWorking Spaces und inwiefern wandeln sich Institutionen wie Bibliotheken und Volkshochschulen, um mithalten zu können? (Zusammenfassung auf edysssee (Esther Debus-Gregor) am 16.04.2017 „Neue Lernräume entdecken: Leuchtfeuer 4.0 – der MOOC„)
Zielgruppen
- Entscheidungsträger/innen, Kreative…
Ursprünglichen Post anzeigen 507 weitere Wörter
Über die Sklaverei. Eine Polemik.

Wenn wir von Sklaverei sprechen, dann produzieren wir vor unserem inneren Auge zuerst einmal materiell benachteiligte Menschen. Menschen mit wenig oder gar keiner Bildung. Menschen, die von anderen Menschen in Lebens- und Arbeitsverhältnisse gezwungen werden, die gemäß unseren aufgeklärten Denkmustern menschenunwürdig sind. Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen, in denen wir uns ein Leben nicht vorstellen mögen. Menschen, die sich nicht selbst gehören.
Anschließend deponieren wir das so konstruierte Phänomen der Sklaverei im konkreten Irgendwo. Dieses Irgendwo zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es „woanders“ ist. Wir legen die Sklaverei an Orten ab, die weit weg sind von den Orten, an denen wir arbeiten und leben. Wir ver-orten Sklaverei in „der dritten Welt“ oder dort, wo Schurkenstaaten von Arbeitssklaven Fussball- und Olympiastadien bauen lassen – oder wir legen sie ganz und gar in der afro-amerikanischen Vergangenheit ab, wie ein Blick in die Bildkartei von Google zeigt. Wir lassen also innere Bilder warm werden von Menschen mit anderer, bevorzugt dunklerer Hautfarbe. Wir erinnern unseren Nachwuchs mit erhobenem Zeigefinger oder grellem Powerpoint-Marker an die Völkermorde und Holocauste dieser Welt und stimmen in den Chor der Aufgeklärten ein, dass das alles nie wieder geschehen darf. Luther-King-reloaded. Dabei ist das Phänomen der Sklaverei weder in der „dritten Welt“ noch sonst wo überwunden oder abgeschafft. Es ist auf bizarre Weise selber versklavt.
Sklaverei ist allgegenwärtig
Einerseits ist das, was wir in einem immer kleiner werdenden Teil der Welt „Wohlstand“ nennen, durch die Zunahme von Sklaverei, Ausbeutung und Vernichtung der Lebensgrundlagen in einem immer größer werdenden Teil der Welt erkauft. Durch Vernichtung bestehender Lebensgrundlagen, kultureller Kräfte und Traditionen, durch fortwährende geistige, materielle und ökonomische Kolonialisierung. Was wir Wohlstand nennen, lebt vom Export all jener Faktoren, die ihn gefährden könnten. Das reicht von prekären Arbeits- und Produktionsbedingungen, über fortwährend fehlende medizinische Versorgung, die Abwesenheit sozialer Sicherungssysteme bis zu einer Bildung, die nicht über Lesen/Schreiben/Rechnen hinaus geht – wenn sie überhaupt bis zu diesem Punkt existiert.
So wie wir aus den „armen Ländern“ bevorzugt die Rohstoffe importieren, um dann aus deren Weiterverarbeitung den eigentlichen Profit zu schlagen, so exportieren wir genau dadurch quasi im Gegenzug die „Rohstoffe“, aus denen dann andernorts Konflikte entstehen und Umweltverschmutzung und Ausbeutung: Es ist vor allem der Kampf um Rohstoffe, um Wasser und Land, der gegenwärtig zum Konflikttreiber Nummer eins geworden ist. Weltweit. Und dieser Kampf ist der Hauptexportartikel der ersten Welt. Die einzigen, die davon vordergründig profitieren, sind wir und unsere Geschäftspartner vor Ort. Was der Nahrungsmittelkonzern Nestlé z.B. weltweit zum Thema „Trinkwasser“ ungestraft und unter den Augen all derer praktiziert, die über Internetanschluss verfügen, schreit zum Himmel.
Zwar reden wir davon, dass heute insgesamt weniger Menschen an Hunger, Krankheit und mangelnder Bildung leiden. Zugleich wissen wir aber sehr genau, dass die Abwesenheit solcher Übel allein keinerlei Garant für Lebensqualität darstellt, oder dass dadurch inhumane Gender-Traditionen überwunden würden, oder religiösen Fanatismen der Boden entzogen. Nichts davon findet statt. Und wir wissen auch, dass der Anteil der Hungernden, Kranken und nicht Gebildeten zwar im Vergleich zu den Gesamtbevölkerungszahlen abnehmen mag, dass dieser vermeintliche Fortschritt aber durch das dramatische Wachstum der Bevölkerung und die zunehmend ungleiche Verteilung der Gesamtanteile an materiellen Reichtümern längst eingeholt ist.
Die unsichtbare Sklaverei vor der eigenen Haustür
Andererseits feiern die Kernelemente klassischer Sklaverei in unseren eigenen Breiten fröhlich Urständ. Natürlich kann man diese Verwendung des Begriffes hinterfragen oder sogar verneinen, denn ursprünglich besteht das Wesen der Sklaverei ja darin, dass ein Mensch „vorübergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt“ wird. Mich treibt allerdings in diesem Zusammenhang der folgende Gedanke um: Kann ich wirklich nur dann und solange von Versklavung reden, wenn andere mich als ihr Eigentum behandeln? Oder ist es denkbar, dass es sich auch dann um Versklavung handelt, wenn ich das mit mir selber mache: Mich als Eigentum behandeln? Mir so vorkommen, als könnte „man“ ganz generell einen Menschen besitzen – sich also selbst an die Kette legen. Ein konkretes Beispiel:
Im Prinzip hat die Firma in der und für die wir arbeiten, vor allem eine Funktion in unserem Leben: Wir brauchen sie als die große Ausrede, warum wir genau so leben müssen, wie wir es tun, als Ausrede dafür, warum sich nichts ändern kann, und warum wir so weitermachen müssen wie bisher. Egal wo ich hinhöre, aus den Sprechblasen klingen mir die Argumente von Sklaven entgegen: Wenn wir uns bewegen, spüren wir einzig unsere Ketten. Dann denke ich mir: Ja, womöglich leben wir noch immer, wieder neu, erst recht in einem Zeitalter, in dem die arbeitende Klasse versklavt ist, sich ducken muss und den Mund halten. In dem sie keine Wahl hat und froh sein muss um ihren Job. Nur: Im Unterschied zu den Zeiten, in denen der Mensch durch andere Menschen versklavt wurde, ist es heute so, dass wir selbst es sind, die sich versklaven. Weil wir einen Lebensstandard für unverzicht- und unaufgebbar halten. Einen, der diese Welt (und den Großteil der Menschheit) erstickt. Einen Lebensstil, der selbst wenig anderes ist als eine Versklavung.
Was kommt nach dem Ende des „Brot-und-Lohn-Märchens“?
In wenigen Jahren wird das „Brot-und-Lohn-Märchen“ zu Ende erzählt sein, weil es zum einen nur noch einen Bruchteil der Arbeit gibt, die wir heute als unverzichtbar wähnen, und zum anderen weil das, was an Arbeit übrig bleibt oder neu entsteht, nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir heute dafür halten. Wie bereit bin ich? Was tu ich, um bereit zu sein? Wie bereite ich mich vor?
Es gibt bereits zahlreiche Möglichkeiten, der eigenen Freiheit und ihrer Potenziale habhaft zu werden und das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Die eigene Lebensgeschichte in Zukunft selbst, kreativ und anders weiter zu schreiben. Zusammen mit anderen, die „vom Weg abkommen, weil sie sonst auf der Strecke bleiben“ (Reinhard K. Sprenger).

Leuchtfeuer 4.0 ist so ein konkretes Konzept. Ein Einsteiger für solche, die Mitstreiterinnen suchen und Weggenossen. Mitdenker und Kollaborateure.
Auf die Politik zu warten, ist hingegen brandgefährlich. Ebenso wie auf das Bildungssystem oder auf die Ökonomie. Diese drei interpretieren ihren Auftrag gemeinsam im Sinne des Erhalts bestehender Abläufe und Strukturen. Sie lassen Innovation und Wandel nur zu, solange sie sich dadurch selbst erhalten können. Zudem umgeben sie sich mit einer Beraterkultur, die als Profi-Optimisten unterwegs sind. Angehörige wirtschaftsnaher Think-Tanks, die uns fast täglich mit Tabellen, Skalen und Keynotes darüber versorgen, wie gut es „uns“ (?) doch eigentlich geht.
Das sind in meinen Augen Pseudopropheten in dem Sinne, wie sie schon das Neue Testament kannte: Menschen, die denen nach dem Mund reden, von denen sie ihren Lohn beziehen, weil sie von denen ihren Lohn beziehen. Sie sind selber Sklaven. Sie skizzieren das Schlaraffenland auf den Horizont und lösen damit bei uns, den überforderten Zweiflern, ein Gefühl der Entlastung aus. Ähnlich wie eine Vielzahl psychotherapeutischer Schulen und Coachingtheorien, die vor allem das Leben in der Sklaverei erträglicher machen, nicht den Ausbruch wünschbar.
Die Metapher, die mich zu dieser Thematik immer wieder heimsucht, ist die vom Gefängnisseelsorger. Er besitzt den Schlüssel zu meiner Zelle, um mich regelmäßig zu besuchen und um mir Trost zu spenden – anstatt den Schlüssel nachmachen zu lassen um ihn heimlich unter meinem Kopfkissen zu deponieren, damit ich immerhin der Möglichkeit meiner Freiheit gewahr werde. Aber wie wusste schon der selige Martin Perscheid in einem ähnlichen Bild zu malen:

Geistig limitiert

Je limitierter die Auflage, um so wertvoller das einzelne Stück. Limitiert ist wertvoll: Es gibt nicht viel davon. Wovon auch immer. Limitiert ist begrenzt. Im Falle der Kunst ist damit die Auflage gemeint. Umgekehrt: Je grösser die Auflage, um so kleiner der Wert. Die limitierte Stückzahl macht auch Weine, Autos und Münzen zu begehrenswerten Objekten.
Eine merkwürdige Umkehr der Vorzeichen, denn: Ist Begrenztheit nicht eher ein Anzeichen von Mangel? Zu wenig Zeit, zu wenig Geld, zu wenig Arbeit, zu wenig Bildung, zu wenig Menschlichkeit, zu wenig Arbeitsplätze, zu wenig Hirn.
Aber das ist ja etwas ganz Anderes. Schließlich geht es bei der limitierten Auflage um die Einzigartigkeit. Ähnlich dem Lebenspartner, dessen Auflage quasi auf ein Exemplar reduziert bleibt. Zumindest phasenweise.
Und selbst der Mangel kann, wird er einmal auf eine spirituelle Ebene gehoben, zum Wert werden. Dann entsteht der Verzicht, und der ist schließlich gewählt.
In irgendeiner Form bildet Limitierung also eine Auszeichnung. Aber was verleiht der Limitierung nun endlich ihren Wert?
Was nur in geringer Zahl vorhanden ist, wird von selbst zu einem Wert. Egal, ob man davon hat oder nicht. Nur wird es eben im einen Fall schmerzlich vermisst, im anderen stolz präsentiert. So etwa von einer Gesellschaft, der die eigenen Werte abhandengekommen sind. Von nun an wird sie sie feierlicher emporhalten und hartnäckiger verkündigen, als je zuvor.
Es ist paradox, dass man gerade an dem, was man nicht hat, am meisten festhält. Es geht einem nicht mehr aus dem Sinn. Wie dem Hungrigen das Brot.
Und so wird der Mangel zum Nährboden des Heiligen. Wo nichts mehr wächst, gedeiht das Unerreichbare ebenso wie die Sehnsucht danach: Der perfekte Körper, die ewige Jugend, das große Geld.
Ist also nur das für mich von Wert, was ich nicht habe? Nicht unbedingt. Und überhaupt: Wer es hat, ist nicht so wichtig, Hauptsache, es gibt nicht viel davon. Eine Welt voller schlanker Ewigjunger sieht keinen Grund mehr, sich nach ihnen zu sehnen. Dann werden es womöglich die jungen Schlanken sein, die als Erste das Ideal des molligen Reifseins ins Netz projizieren.
Was bleibt, ist nicht viel: Wertvoll wird etwas dadurch, dass es nur wenig davon gibt. Und vielleicht hat auch diese Einsicht nur deswegen einen Wert, weil sie limitiert ist?
Wie auch immer: Limitiert ist wertvoll. Und nur, wenn das so bleibt, lässt sich mit kostbaren Einsichten Geld verdienen oder Aufmerksamkeit gewinnen. Wird der Markt erst mal mit Einsichten überschwemmt (und das ist die Welt wohl heute: ein Markt), dann werden die immer wertloser, wie die Inflation unseres Wissens z.B. in Klimafragen zeigt.
Eine grauenvolle Vorstellung. Vielleicht sollte man auf Einsichten eine Steuer erheben – oder zumindest eine Einfuhrbeschränkung. Wäre das nicht eine zeitgemäße Form von Knowledge Management? Die zugehörige proficiency müsste natürlich noch kreiert werden. Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt – solange daraus keine Einsicht wird.