Immer wieder wird nachgewiesen, dass Schulnoten ungerecht sind. Jüngst durch eine Studie von Chantal Oggenfuss und Stefan Wolter, die von Philippe Wampfler in einem Blogpost aufgegriffen wurde: Mädchen erhalten bessere Noten als Knaben, Kinder mit anderer Erstsprache schlechtere, und wer in einer besonders starken Klasse sitzt, wird zusätzlich benachteiligt. Bis zu 0.6 Noten Unterschied bei gleicher Leistung. Für mich lautet die Frage deshalb schon längst nicht mehr, ob Noten ungerecht sind, sondern warum. Warum ist Schule selbst ein Ort, der Ungerechtigkeit produziert und verstärkt, und warum wird das so selten ausgesprochen?
Noten sind nur das Symptom
Noten sind nicht Ursache schulischer Ungerechtigkeit, sondern sichtbarer Ausdruck einer Schule, die auf Vergleich, Selektion und Homogenisierung angelegt ist. Auch differenzierte, dialogische Bewertungsformen können diese Logik nicht aufheben, denn schulische Bewertung ist als solche immer voraussetzungsreich und reproduziert bestehende Unterschiede.
Solange Gleichzeitigkeit, gleicher Stoff und Vergleich die Organisation von Schule prägen, wirken neue Bewertungsformate lediglich an der Oberfläche. Auch Prozess- oder Teambeurteilung ist unter diesen Umständen immer voraussetzungsreich: Sie verlangt Zeit, gemeinsame Kriterien und diagnostische Kompetenz. Da diese Voraussetzungen ungleich verteilt sind, entstehen wieder neue Ungleichheiten. Zudem machen Bewertungen – ob durch Noten oder durch Alternativen – Unterschiede institutionell wirksam, etwa bei Übergängen und Zugängen, und stabilisieren damit die bestehende Logik.
Schule braucht die ihr eigene Logik der Ungleichheit, um überhaupt funktionieren zu können. Ausgangspunkt dieser Logik ist die widerlegte Grundannahme, dass Lernen von aussen und institutionell steuerbar sei. In dem Moment, wenn Lernen als steuerbar gedacht wird, erscheint Messbarkeit als notwendige Voraussetzung von Steuerung. Dadurch wird Messbarkeit zur Bedingung institutioneller Legitimation.
Schule versteht sich als steuerbare Organisation, die das Lernen, seine Prozesse, seine Inhalte und Ziele reglementiert, und die ihre Legitimation aus „Kontrolle und Rechenschaft“ bezieht.
Adressat dieser Steuerung ist – anders als es auf den ersten Blick erscheinen – primär die Organisation Schule selbst: ihre Prozesse, Ressourcen und Übergänge. Die hierfür genutzten Messwerte stammen jedoch aus dem Lernen der Kinder und Jugendlichen. Sie fungieren als Stellvertretergrössen für die Steuerbarkeit der Institution.
Die dahinterliegende Absicht ist also: Handlungen der Schule sollen nachweisbar, kontrollierbar und administrativ verantwortbar sein. Messung ist in diesem Sinne ein Instrument institutioneller Selbstabsicherung. Schule behauptet dadurch Rationalität und Objektivität, um gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit Rechenschaft ablegen zu können.
Mit anderen Worten: Nicht Lernen steht im Zentrum, sondern die Legitimation der Steuerung. Lernen wird messbar gemacht, damit Schule organisiert werden kann.
Um Messbarkeit herzustellen, koppelt Schule vorhandene sprachliche, kognitive, biografische, soziale und körperliche Unterschiede, also jene Heterogenität, die Lernen überhaupt ermöglicht, systematisch an Kennwerte. Erst durch diese Kopplung werden Unterschiede zu Messobjekten, aus denen dann Steuerungsgrössen, Zuteilungen und Rechenschaft abgeleitet werden. Die implizite Annahme lautet:
Ohne messbaren Unterschied keine legitime Steuerung, ohne Steuerung keine Institution.
Entscheidend für jene Ungerechtigkeit, die Schule hervorbringt, sind deshalb nicht die Unterschiede als solche sondern ihre Verwandlung in Vergleichswerte. Wenn wir Bildungsgerechtigkeit anstreben, müssen wir diese Kopplung lösen: Unterschiede sollen sichtbar bleiben und für das Lernen wirksam werden, ohne automatisch in Rankings, Übergänge oder Ressourcenzuteilungen übersetzt zu werden. Solange die Kette Unterschied → Messung → Steuerung → Legitimation unverändert bleibt, verwalten auch neue Bewertungsformen die Ungleichheit, sie überwinden sie nicht.
Diese „Steuerungsillusion“ findet sich in weiteren Grundformen von Schule wieder:
Unterricht, der lehrt statt lernen lässt
Auch wenn der klassische Frontalunterricht vielerorts methodisch variiert wurde, bleibt das Grundprinzip dasselbe: Inhalte werden autoritativ ausgegeben und Lernende nehmen sie rezeptiv auf, ob als Vortrag, Arbeitsblatt, PDF, Padlet, Lernvideo oder über App. Stoff wird zugewiesen, Zeit wird getaktet, das Tempo setzt die Schule oder die Lehrperson. Diese Logik der Beschulung ist so tief in unsere Vorstellung von Schule eingeschrieben, dass wir sie nicht hinterfragen.
Was dabei passiert, ist fatal: Wer mit dieser Lernlogik vertraut ist, etwa Kinder aus bildungsnahen Familien, mit hoher Sprachkompetenz und ruhiger Lernumgebung zu Hause, kommt gut zurecht. Andere, die anders lernen, werden abgehängt. Hinzu kommen die kompetitiven und hinsichtlich der Kommunikation eher künstlichen Bedingungen des Klassenraums: Es wird um Aufmerksamkeit, Redezeit und Anerkennung konkurriert – in vielen Klassen ist es allerdings genau umgekehrt: „bloss nicht auffallen“. Jedenfalls folgen Gespräche vorgegebenen Rollen und Prüfregimen, das „Publikum“ ist nicht echt. Unterricht sortiert also bereits, bevor überhaupt eine Note gesetzt wird.
Das nennt man strukturelle Ungerechtigkeit. Sie geschieht leise, alltäglich und mit systematischer Wirkung.
Ein Curriculum für alle – und damit für niemanden
Der Lehrplan 21 ist nicht in jeder Hinsicht linear. Er ist in Kapitel und Jahresablauf strukturiert und gibt Takte vor, variiert aber die Linearisierung – zumindest der Möglichkeit nach: Kompetenzen werden über Zyklen hinweg gedacht, Spielräume für thematische Zugänge sind angelegt. Gleichwohl entsteht oder bleibt in der Praxis häufig ein linearer Vollzug.
Wichtige Erkenntnis: Dass alle zur selben Zeit am selben Ort dasselbe lernen, geht nicht ausschliesslich von einem Lehrplan aus, sondern von einer gewachsenen Schulkultur: organisatorische Routinen, Stundenpläne, Prüf- und Zeugnisrhythmen, Erwartungshaltungen von Eltern und Institutionen. Diese Kultur ist älter als jeder Lehrplan und übersetzt Öffnungen des Lehrplans oft zurück in Gleichschritt.
Doch kein Mensch lernt linear. Kinder, und nicht nur sie, lernen sprunghaft, interessengeleitet, durch Umwege, Wiederholungen, Gespräche, Irrtümer.
Wenn alle dasselbe zur selben Zeit lernen müssen, wird Gleichbehandlung plötzlich zum Gegenteil von Gerechtigkeit. Denn gleiche Aufgaben für ungleiche Lernvoraussetzungen bedeuten ungleiche Chancen.
Wer also glaubt, der Lehrplan sorge für Fairness, verkennt: Er sorgt für Ordnung, nicht für Gerechtigkeit.
Klassen: Der Versuch, Heterogenität zu verstecken
Auch die Einteilung in Klassen ist ein Versuch, mit der Vielfalt menschlicher Entwicklung fertigzuwerden. Klassen sind Verwaltungsstrukturen, keine pädagogische Notwendigkeit.
Sie erzeugen eine ganz eigene Form von Ungerechtigkeit, denn Klassen sind nie gleich stark, nie gleich gemischt, nie wirklich zufällig zusammengesetzt. Es gibt Klassen mit hohem Bildungsniveau, motivierten Eltern, gutem Ruf, und es gibt die anderen.
Wer in einer „guten Klasse“ ist, profitiert von der Lernkultur. Wer in einer „schwachen Klasse“ landet, hat weniger Chancen, aufzuholen. Studien belegen das immer wieder: Leistungsstarke Umfelder fördern Lernzuwachs, aber nur für jene, die bereits stark sind. Für alle anderen ist der Vergleich lähmend.
Ein Einwand von Lehrpersonen und Eltern lautet hier: Schule könne Ungleichheit nicht ausblenden, da sie gesellschaftliche Realität widerspiegelt; eine Schule, die dem entgegenwirkt, schaffe eine künstliche Gegenwelt. Genau hier liegt jedoch die pädagogische Aufgabe:
nicht eine Schutzblase zu bauen, sondern Erfahrungsräume zu gestalten, in denen soziale Realität verstehbar, bearbeitbar und veränderbar wird. Schule simuliert die Welt nicht, sie eröffnet Zugänge zu ihr und reduziert dabei systematische Barrieren, statt sie zu normalisieren.
Selektion als nationale Leidenschaft
Nach der Primarschule ist in der Schweiz Schluss mit der gemeinsamen Bildung. Das Sortieren greift endgültig durch: Sekundar, Real, Sek A oder Sek B, Gymnasium, mit all ihren subtilen sozialen Codes.
Was als „Leistungsdifferenzierung“ etikettiert wird, ist in Wahrheit ein Mechanismus sozialer Reproduktion. Denn wer in welchem Zweig landet, hängt nur zum Teil von Leistung ab, die es als individuell herausrechenbares Phänomen ja gar nicht gibt, wie längst erwiesen ist. Die Bildungskarriere hängt vor allem von Erwartungen ab, vom Elternhaus, von der Sprache, von der Lehrperson, die empfiehlt.
Die Forschung ist eindeutig: Systeme mit früher Selektion haben eine grössere soziale Ungleichheit. Und jedes „Durchlässigkeits“-Versprechen kann diesen Grundmechanismus kaum mildern. Für die Schweiz ist es auch längst widerlegt.
Jahrgänge und der Zwang zur Gleichzeitigkeit
Das Jahrgangssystem wirkt harmlos, fast selbstverständlich. Aber es ist eine der stillen Quellen schulischer Ungerechtigkeit.
Kinder, die vor dem 1. August geboren sind, gelten als „schulreif“. Kinder, die ein paar Monate später geboren sind, als „noch nicht so weit“. Ein Jahr Unterschied in der biologischen Entwicklung entscheidet über den schulischen Erfolg und begleitet Kinder bis ins Berufsleben.
Die Idee, dass alle eines Jahrgangs das Gleiche lernen sollen, ist bequem, aber absurd. Kein Jahrgang ist homogen. Der Versuch, ihn homogen zu machen, führt zwangsläufig zu Benachteiligung.
Wenn Schule vergleicht, verliert sie
Vergleiche sind das Herz der Schule: Noten, Rankings, Übertrittsverfahren, Probezeiten. All das soll objektivieren, wer „gut“ und wer „schwach“ ist.
Doch Vergleiche sind niemals neutral. Sie entstehen in einem Feld, das schon vorher ungleich ist, sozial, sprachlich, emotional. Und weil Noten und Tests diese Ungleichheit sichtbar machen, halten sie das System am Leben. Sie legitimieren die Unterschiede, die das System selbst produziert. So wird aus Ungleichheit Normalität.
Der psychologische Blick auf Abweichung von einem festgelegten Mass erzeugt häufig Beschämung. Aus Schamangst passen sich Kinder und Jugendliche an, sie ordnen sich unter, sie unterdrücken Eigenheiten und richten sich nach äusseren Normen. Das macht sie steuerbar und fügt sie leichter in vorgegebene Rollen ein, bis hin zur Haltung als konsumierende Subjekte. Auch dies ist ein Effekt der Kopplung von Unterschied an Vergleichswerte: Nicht die Vielfalt ist das Problem, sondern der Bewertungsrahmen, der sie in Hierarchien übersetzt.
Was jetzt? Eine Schule, die Ungerechtigkeit nicht repariert, sondern überwindet
Wer Gerechtigkeit ernst nimmt, kann Schule nicht durch kosmetische Anpassungen „gerechter machen“. Solange sie denselben Horizont vorgibt, bleiben alle am gleichen Ziel verankert. Gerechtigkeit beginnt dort, wo Schule aufhört, Ziele für alle zu definieren, und stattdessen Wege eröffnet, die sich unterscheiden dürfen. Sie beginnt dort, wo Schule das Prinzip des Vergleichs selbst aufgibt.
- Lernen ohne Zentrum und ohne Rand
Schule hört auf, Lernende entlang einer Skala zu ordnen. Stattdessen entstehen Lernräume, in denen jedes Kind ein eigenes Zentrum bildet. Lernzeit, Themenwahl, soziale Dynamik sind nicht normiert, sondern emergent (aus der Interaktion heraus entstehend, nicht von aussen vorgegeben). Lernen verläuft als Expedition, nicht als Marsch. - Wissen als Ko-Kreation statt Stoffvermittlung
An die Stelle des Curriculums tritt ein Wissensökosystem, das sich aus Projekten, Fragen, Phänomenen speist. Lehrpersonen werden zu Kurator:innen gemeinschaftlich getragener Erkenntnisprozesse. Es gibt keine Stofflisten, sondern Bewegungen des Denkens, dokumentiert in gemeinsam kuratierten Portfolios. - Beziehungen statt Klassen
Lernende gehören nicht mehr fixen Gruppen an, sondern Netzwerken von Zugehörigkeit: Peer-Communities, Projektteams, temporäre Ateliers. Zugehörigkeit entsteht durch Resonanz, nicht durch Zuordnung. Wer etwas versteht, erklärt es anderen; wer etwas sucht, findet Anschluss. - Selektion wird ersetzt durch Einladung
An die Stelle von Übergangsprüfungen treten Übergangsbeziehungen: Selbst gewählte Mentor:innen begleiten Kinder über längere Phasen hinweg. Schule lädt zu nächsten Schritten ein, sie wählt und schliesst niemanden aus. Wege verzweigen sich, statt sich zu verengen. - Zeit als individuelles Narrativ
Jahrgänge lösen sich auf. Jeder Mensch folgt einem eigenen Rhythmus, der dokumentiert wird, nicht bewertet. Lernzeiten sind dehnbar, verdichtbar, pausierbar. Wachstum wird nicht gemessen, sondern erzählt. - Vergleich verliert seine Funktion
Ohne Noten verliert Schule die Notwendigkeit, Leistungen gegeneinander zu stellen. Feedback wird zur gemeinsamen Reflexion, nicht zur Zuteilung von Wert. Beurteilung verwandelt sich in Beziehung: „Wie bist du gewachsen? Was hast du verstanden? Was brauchst du als Nächstes?“ - Bewertung als gemeinsames Bewusstsein
Bewertung heisst, gemeinsam zu verstehen, was gelungen ist. Kinder, Lehrpersonen, Eltern, Peers reflektieren gemeinsam Fortschritt und Verantwortung. Kein Ranking, sondern Resonanz. Kein Ergebnis, sondern Prozess. - Verantwortung neu gedacht
Gerechtigkeit wächst, wenn Verantwortung geteilt wird: für den Raum, für das Lernen, für die Gemeinschaft. Lehrpersonen sind nicht mehr Gatekeeper, sondern Gastgeber. Schule wird zum Gemeingut, nicht zur Institution, die sortiert.
Das ist kein Katalog von Reformen. Es ist eine Richtungsänderung: weg von Schule als Maschine der Gleichmacherei, hin zu Bildung als lebendigem, gemeinschaftlichem Werden.
Fazit
In der Schweiz ist vielen Akteur:innen längst klar, dass Schule Teil des Problems ist. Entscheidend ist nun, was wir daraus folgern und strukturell verändern. Dabei ist die Notenfrage bereits entschieden: Noten können endgültig verschwinden. Im Zentrum steht jetzt die Veränderung der Strukturen, also von Lernräumen, Zeit und Übergängen. Es geht jetzt um einen grundlegenden Perspektivwechsel: Weg von der Idee, dass Gerechtigkeit durch Gleichheit entsteht, hin zu einer Schule, die Vielfalt als Prinzip versteht und gestaltet.
Gerechtigkeit in der Bildung beruht auf drei ineinandergreifenden Ansätzen.
- Erstens: Strukturelle Gerechtigkeit entsteht, wenn Lernräume, Zeit und Übergänge so gestaltet sind, dass Unterschiede nicht ausgeglichen, sondern anerkannt werden.
- Zweitens: Politische Gerechtigkeit verlangt den Mut, Selektion als zentrales Steuerungsprinzip abzulösen und sie durch Offenheit, Einladung und Durchlässigkeit zu ersetzen.
- Drittens: Evidenzbasierte Gerechtigkeit braucht Transparenz, Schulen müssen ihre eigenen Ungleichheitseffekte erfassen, sichtbar machen und gezielt abbauen. In Begriffen der Systemlogik lässt sich das so fassen: Ohne Unterschied keine Messung, ohne Messung keine Steuerung, ohne Steuerung keine Institution. Genau diese Kette gilt es zu durchbrechen, wenn Schule gerecht werden soll.
So verstanden ist Gerechtigkeit keine pädagogische Methode, sondern eine Haltung, die in Struktur, Politik und Praxis verankert werden muss. Eine Schule, die sich auf diesen Weg macht, hört auf zu vergleichen und beginnt, Unterschiede produktiv werden zu lassen, als Grundlage für gemeinsame Entwicklung.


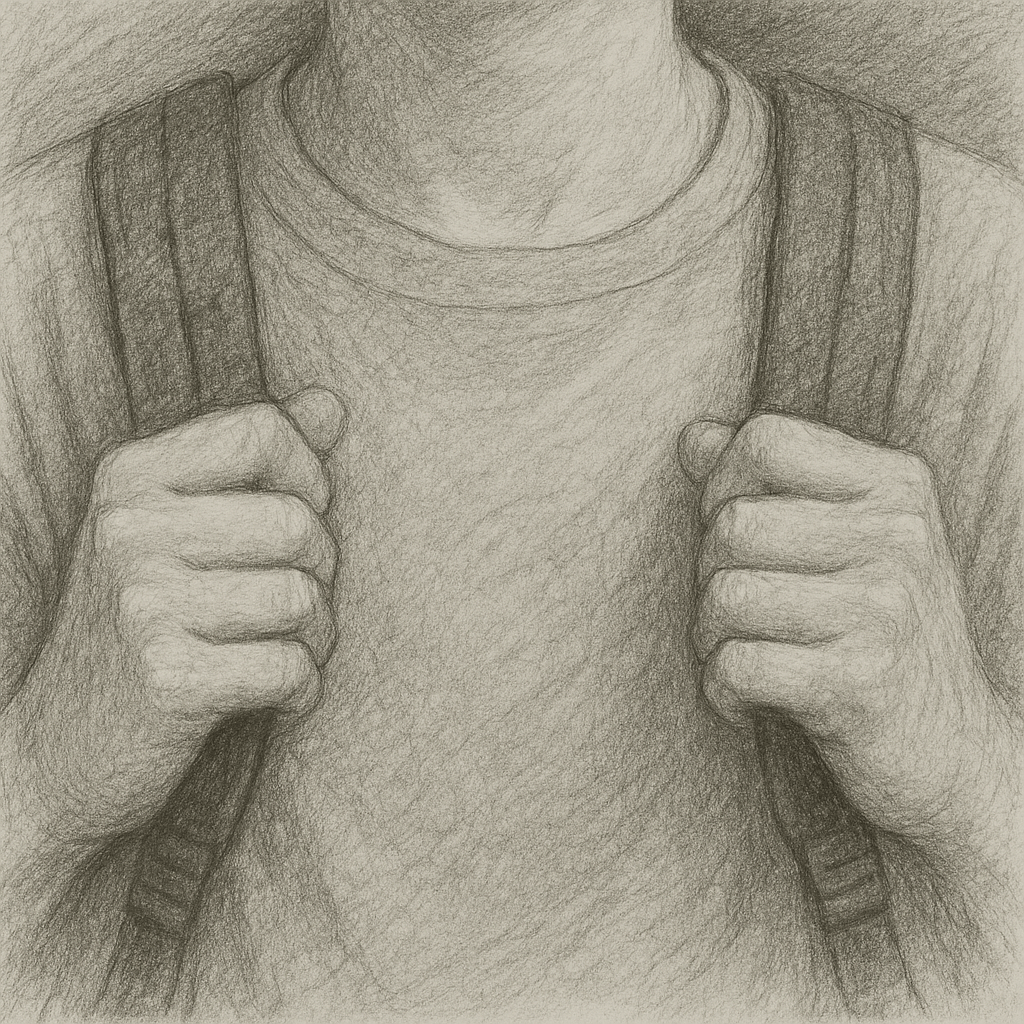
Ein Gedanke zu „Die Note als Symptom. Warum Schule Ungerechtigkeit braucht, um zu funktionieren“