In unserer Gesellschaft ist ein Narrativ vorherrschend, das kaum jemand infrage stellt, weil es so vernünftig klingt: Verantwortung übernehmen, an sich arbeiten, nicht aufgeben. Doch was als Selbstermächtigung daherkommt, ist in Wahrheit die ideologische Absicherung eines Systems, das seine Zumutungen auf das Individuum abwälzt – und es dann auch noch dafür verantwortlich macht, dass sich die grossen Fragen unserer Zeit lösen: das Bildungssystem, die Wirtschaft, die Klimakrise. Alles scheint davon abzuhängen, ob wir genug reflektieren, uns genug bemühen, uns ausreichend selbst optimieren. Dieser Blogpost plädiert dafür, diese Illusion zu durchbrechen und gemeinsam neu zu denken, was Veränderung eigentlich braucht. Denn nicht du bist das Problem. Es sind die Verhältnisse, die dich allein lassen, und die du allein nicht ändern kannst.
Es ist bemerkenswert, wie zäh sich dieses Narrativ nicht nur hält, sondern den öffentlichen Diskurs derart bestimmt, dass es kaum noch entlarvt werden kann. Es zieht sich durch sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft: In die Sprache von Lehrpersonen, in die Logik von Schulnoten, in die Rhetorik von Coaching-Angeboten, Achtsamkeitskursen, LinkedIn-Postings, Führungstrainings, Gesundheitsapps. Es lautet in unzähligen Varianten, aber immer mit demselben Subtext:
„Du musst dich nur genug anstrengen. Sei achtsam, sei aktiv, bleib positiv. Verändere dich, dann verändert sich der Rest.“
Da ist ein Welt- und Menschenbild entstanden, das freundlich daherkommt, aber brutal wirkt. Denn was es im Kern sagt, ist dies: Wenn dir das alles nicht gelingt, liegt’s an dir bzw. an sonst jemandem, der es „endlich ändern könnte“.
Aber es liegt nicht an dir oder mir oder ihm oder ihr. Die Welt um uns brennt, und man reicht uns eine Atemübung, oder ein Achtsamkeitsseminar, oder einen Podcast über Resilienz. Als ob persönliche Gelassenheit genügen würde, um strukturelle Brände zu löschen.
Genau darin zeigt sich die Absurdität eines Narrativs, das scheinbar Hilfe anbietet, aber im Kern Verantwortung verschiebt; nicht nur für das, was misslingt, sondern auch für das, was gelingen soll. Es tut so, als läge die Kraft zur Veränderung in der Summe individueller Anstrengung.
Dadurch wird verschleiert, wie sehr unsere Möglichkeiten von den Verhältnissen abhängen, in denen wir leben.
Nämlich in einer Zeit multipler Erschütterungen. Kriege, die kein Ende nehmen, ein Klimakollaps, der längst nicht mehr vor der Tür steht, sondern das Haus bereits unterspült, Pandemien, die das öffentliche Leben über Jahre lähmen, Ökonomien, die mit Daten und Wachstum jonglieren, aber reale Menschen entwerten und eine Bildungskultur, die Kindern früh einbläut, dass sie ihren Wert erst erarbeiten müssen.
Und während all das geschieht, während alles komplexer und brutaler wird, wird das Individuum zum letzten Anker der Hoffnung erklärt. Nicht Gerechtigkeit, nicht Solidarität, nicht Veränderung der Strukturen, sondern: Du musst dich ändern. Dann wird alles gut. Dann wird dein Leben gelingen. Dann wirst du gesund, erfolgreich, resilient. Dann wirst du sichtbar, achtsam, leistungsfähig – und endlich richtig.
Diese systemische Illusion ist die gefährlichste Ideologie unserer Zeit. Nicht nur weil sie falsch ist, sondern weil sie so plausibel klingt. Weil sie so tröstlich daherkommt. Dabei zerstört sie das Gespür für Gerechtigkeit. Sie zerstört das Verständnis dafür, wie tiefgreifend soziale und ökonomische Ungleichheit verankert ist. Sie pulverisiert die Vorstellung davon, dass wir unsere Lebensverhältnisse nur gemeinsam und strukturell verändern können.
Mehr noch: Sie verhindert, dass sich ein falsches Verständnis von den Bedingungen für Veränderung überhaupt erst entwickeln kann. Wer glaubt, das Entscheidende liege an ihm oder ihr selbst, stellt keine Fragen mehr an die Verhältnisse. Das wirkt nicht nur entpolitisierend, sondern lähmend, weil es das System zum blinden Fleck macht und Veränderung zur Privatsache erklärt.
Gerade diese Plausibilität macht die Illusion so gefährlich: Sie klingt vernünftig, empathisch, verantwortungsvoll, und doch wirkt sie in die entgegengesetzte Richtung. Sie macht den Einzelnen und die Einzelne zum Träger und zur Trägerin kollektiver Lasten, ohne ihm oder ihr kollektive Mittel zur Verfügung zu stellen. Und so entzieht sie der Gesellschaft die Fähigkeit zur systemischen Einsicht. Was bleibt, ist eine Sprache der Erschöpfung, nicht der Veränderung.
Das Märchen von der Selbstoptimierung
Dieser Vorgang beginnt früh, bereits in der Schule, wenn Kinder lernen, dass ihr Wert von ihrem Fleiss abhängt, dass Leistung belohnt wird, und dass sich Anstrengung auszahlt. Wenn sich diese Anstrengung nämlich nicht auszahlt, dann war sie eben nicht gross genug. So einfach ist das. So brutal ist das.
Die strukturellen Unterschiede zwischen Kindern, also ihre Herkunft, ihr soziales und kulturelles Kapital, ihre Sprache, ihr psychisches Fundament und ihr Zuhause, verschwinden hinter einer pädagogischen Erzählung, die Chancengleichheit verspricht, als wäre die Gleichheit des Anspruchs schon die Gleichheit der Bedingungen.
Wir übernehmen diese Vorstellung, machen sie zu unserer eigenen und erzählen sie weiter: an Elternabenden, in Personalgesprächen, in Therapieangeboten und in der Sprache des Fortschritts. Mit jeder Wiederholung wächst das Missverständnis, dass Entwicklung eine Frage des Wollens sei und Scheitern ein Hinweis auf individuelle Defizite.
Bereits die Schule ist also nicht einfach ein Ort des Lernens, sondern ein Ort der Wiederholung. Sie wiederholt eine Erzählung, die längst zur Struktur geworden ist: Wer sich anstrengt, wird belohnt. Wer scheitert, war nicht fleissig genug. Diese Erzählung bestimmt nicht nur, was gesagt wird, sondern formt auch, was geschieht. Und umgekehrt bestätigt die tägliche schulische Praxis genau diese Erzählung. Beide – Praxis und Erzählung – greifen ineinander, bestärken sich gegenseitig. Sie bilden einen Kreislauf aus Sinn und Struktur, aus Sprache und Handlung. So wird aus dem Narrativ eine Wirklichkeit. Und aus einer Wirklichkeit ein System.
Ein System, das nicht auf Einsicht angelegt ist, sondern auf Reproduktion. Schule als geschlossene Schleife: Sie produziert genau das Denken, das sie selbst am Leben hält. Nicht aus Böswilligkeit, nicht weil Lehrpersonen das so wollen, sondern weil sie im Auftrag eines Systems handeln, das Verantwortung individualisiert und Strukturen unsichtbar macht.
Schule ist der Ort, an dem Kinder lernen sollen, wie die Welt funktioniert, und sie lernen dort zuallererst, dass sie selbst verantwortlich sind für das, was aus ihnen wird.
Das Schulsystem ist nicht darauf ausgerichtet, Menschen zu verstehen, sondern darauf, sie zu klassifizieren, zu sortieren, zu formalisieren, damit sie später in ein System passen, das ihnen dann sagt, ob sie es geschafft haben.
Das pädagogische Leistungsversprechen – wenn du dich anstrengst, wirst du etwas erreichen – ist die Grundmelodie schulischer Kommunikation. Sie wird so oft wiederholt, bis sie im Selbstbild der Schüler:innen als Wahrheit ankommt.
Was Kinder in der Schule lernen, ist dies: Wer scheitert, war nicht fleissig genug. Wer nicht mithalten kann, gilt als Störfaktor, nicht als Anlass zum Innehalten, sondern als Argument für Separation. Wer sich dem System nicht nahtlos anpasst, soll ausgegliedert werden. Wer zu leise, zu laut, zu müde, zu unsicher ist, ist kein Mensch mit Geschichte, sondern ein Fall. So wird die pädagogische Sprache zur politischen Botschaft: Nicht alle gehören dazu. Und wer nicht funktioniert, wird – nach einer Phase der Sanktionierung – systematisch aussortiert.
Aus systemischer Perspektive ist Schule gezwungen, Menschen so zu bewerten, dass individuelle Leistung zählt, aber strukturelle Bedingungen unsichtbar bleiben.
Diese Prägung begleitet viele Menschen ein Leben lang. Sie bestimmt, wie sie über sich selbst denken, wie sie mit Krisen umgehen, wie sie mit der Welt in Beziehung treten. Denn was in der Schule beginnt, endet nicht mit dem Schulabschluss. Es wandert mit: an die Universität, in die Arbeitswelt, in die Therapie, ins Coaching. Dieselbe Logik der Verantwortungsverschiebung erscheint später in sanfterer Sprache, unter neuen Begriffen, mit neuen Versprechen. Doch der Geist bleibt derselbe: Nicht die Welt soll sich ändern, du sollst dich ändern.
Wie Selbstverantwortung zur Selbstbeschwichtigung wird
In dieser Welt, die ja komplett aus den Fugen gerät, wird das Bedürfnis nach Halt immer stärker. So entstehen Räume der Reflexion, der Orientierung, der Neujustierung: Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung, resilienzfördernde Programme, achtsamkeitsbasierte Therapien, Beratungsformate aller Art. Sie versprechen Stabilisierung, Selbstwirksamkeit und neue Perspektiven. Doch sie operieren im Modus des Trojanischen Pferdes: Sie deuten strukturellen Druck in persönliche Herausforderung um und machen individuelles Verhalten zum Schlüssel für gesellschaftliche Lösungen. Der Gaul kommt im Gewand der Freiheit daher, doch im Inneren trägt er eine andere Botschaft: Du bist für alles zuständig. Für dein Glück, dein Scheitern, deine Gesundheit, deinen Erfolg und für die Welt, die dich überfordert.
Was als pädagogische Norm beginnt – sei verantwortlich, streng dich an – wird später zum Coachingziel: fokussiere deine persönlichen Grenzen, arbeite an ihnen, und finde dich mit den strukturellen Gegebenheiten ab. So wandert die Disziplin von aussen nach innen. Der Druck bleibt, das Vokabular wird weicher: Was früher durch äussere Autoritäten gefordert wurde, verlagert sich ins Innere. Wir übernehmen den Druck, kontrollieren uns selbst, passen uns an und glauben dabei sogar, frei zu sein.
Im Coaching etwa lerne ich, mit mir selbst zu arbeiten statt mit der Welt. Ich lerne, äussere Grenzen zu akzeptieren statt sie zu verschieben. Ich lerne, aus der Ohnmacht eine Haltung zu machen. Ich lerne, zu mir zu kommen, aber nicht dorthin, wo ich mich gegen Verhältnisse wehren würde. Achtsamkeit ersetzt Kritik, Selbstfürsorge ersetzt Solidarität, Persönlichkeitsentwicklung ersetzt politische Analyse.
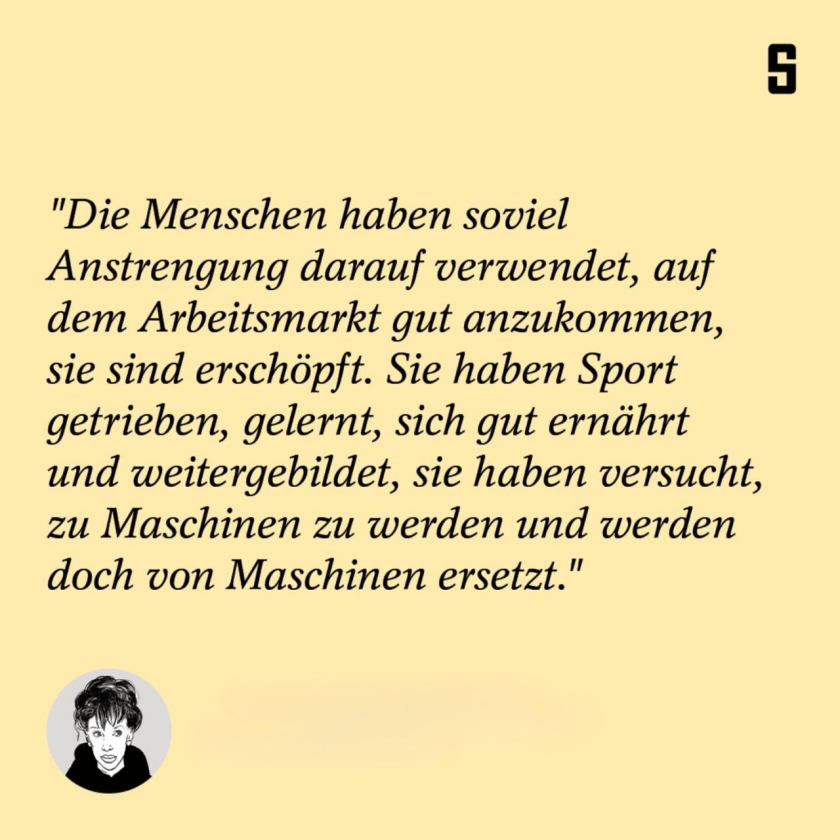
Und so wird aus einem Impuls, der einmal radikal war – nämlich das eigene Leben in die Hand zu nehmen –, eine Form der Stillstellung. Ursprünglich bedeutete dieser Impuls, sich gegen fremde Bestimmung zu wehren, für gerechte Verhältnisse einzustehen, die eigene Stimme zu finden und gemeinsam mit anderen für Veränderung zu kämpfen. Er war ein Akt der Befreiung, nicht nach innen, sondern nach aussen gerichtet.
Heute klingt er noch immer ähnlich, doch seine Bedeutung hat sich verschoben: „Gönn dir eine Pause. Finde deine Mitte. Atme durch. Meditiere über dein Problem, aber sprich nicht über seinen Ursprung.“ Was einst Widerstand war, ist heute Selbstfürsorge. Was einst Befreiung meinte, meint heute Anpassung. Nicht die Verhältnisse sollen sich ändern, sondern du.
Das Sprechen über Selbstverantwortung übernimmt die Begriffe der Befreiung – aber nicht mehr ihren Sinn.
Anders gesagt:
Worte wie Selbstbestimmung, Freiheit, Stärke, Verantwortung, Gestaltungskraft klingen auf den ersten Blick nach Emanzipation. Doch im heutigen Diskurs werden sie nicht mehr als Forderung nach kollektiver Handlungsfähigkeit oder struktureller Veränderung verstanden, sondern als Appell an das Individuum, sich selbst zu optimieren, sich selbst zu helfen, sich selbst zu verbessern, egal wie die Verhältnisse aussehen.
Der Begriff „Befreiung“ meint nicht mehr „Ich erkenne die strukturellen Ungleichheiten, gegen die ich mich mit anderen gemeinsam wehre“, sondern „Ich lerne, besser mit der Ungleichheit zu leben und sie nicht mehr als Problem zu empfinden“.
Die Sprache der Befreiung wird zur Sprache des Überlebens. Nicht mehr das System erscheint bedrohlich, sondern die eigene Unzulänglichkeit. Und so lernen selbst die Privilegierten, sich als permanent bedroht zu empfinden (vom eigenen Scheitern, vom Bedeutungsverlust, vom sozialen Abstieg, von der Erschöpfung ), während die Marginalisierten nicht einmal den Begriff dafür bekommen, was ihnen fehlt.
Was hier als Heilung daherkommt, ist Teil der Krankheit. Die Verantwortung für sich selbst bedeutet unter neoliberalen Bedingungen: Du bist auch verantwortlich für das, was du gar nicht kontrollieren kannst: Für den Druck, unter dem du leidest, für die Ungleichheit, die dich benachteiligt; für die Krise, die du nicht verursacht hast.
Natürlich ist es verständlich, dass Menschen sich stabilisieren wollen, zur Ruhe kommen, lernen, besser mit sich und anderen umzugehen. Doch im Schatten der systemischen Verwerfungen verschiebt sich die Bedeutung: Aus Selbstfürsorge wird ein Ersatz für Gerechtigkeit. Achtsamkeit ersetzt Kritik, Selbstoptimierung ersetzt Solidarität, Resilienz ersetzt strukturelle Veränderung.
„Sowohl als auch“: Die Rhetorik der Entlastung
Besonders trügerisch wirkt in diesem Kontext das viel bemühte „sowohl als auch“, also jene Haltung, die sich als differenziert ausgibt, aber in Wahrheit zur Entschärfung beiträgt: Wir sollen achtsam sein und gleichzeitig strukturell denken; uns selbst verändern und gleichzeitig die Welt; resilient sein und zugleich kritisch.
Doch dieses „sowohl als auch“ ist selten dialektisch, sondern ein rhetorischer Trick. Es erlaubt, alles zu sagen und nichts zu meinen, Haltung zu behaupten und doch jede Verantwortung zu vermeiden. Es wirkt offen, ist aber entwaffnend: Wer alles mitdenkt, stellt nichts mehr in Frage, denn es gilt ja immer beides.
In einer Kultur, in der das Individuum für alles verantwortlich gemacht wird – für sein Glück, seinen Erfolg, seine psychische Gesundheit –, wird das „sowohl als auch“ zur Entlastungsformel. Es klingt differenziert, aber es verhindert Konsequenz. Es wirkt verbindend, aber es verhindert Veränderung.
So wird aus Ambivalenz ein strategischer Stillstand: Wer sich nicht entscheiden muss, muss auch nichts verändern. Und wer nichts verändert, stellt die Verhältnisse nicht infrage. Genau darin liegt die Funktion des „sowohl als auch“ im neoliberalen Diskurs: Es schützt das System vor Kritik, indem es den Einzelnen zur Aushandlung auffordert, ohne dass sich das System selbst bewegen muss.
An diesem Punkt wird Selbstsorge zur politischen Falle. Während die Welt aus den Fugen gerät, erfahren Angebote wie Achtsamkeit, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung einen Boom. Doch was als Hilfe erscheint, ist eine leise, achtsame Form der Kapitulation.
Die Illusion der individuellen Verantwortung
Besonders perfide wird es, wenn dieses Denken beginnt, gesellschaftlich relevante Bereiche zu durchdringen: die Bildung, die Sozialarbeit, die Arbeitswelt, die Politik. Denn dann reicht es nicht, dass die Einzelnen sich überfordert fühlen. Dann beginnt das System selbst, sich über sie zu entlasten.
Zu diesem Zweck wird die Denkfigur, dass gesellschaftlicher Wandel doch bei den Einzelnen beginnen müsse, reflexhaft verteidigt. Wer sie kritisiert, sieht sich schnell dem Vorwurf ausgesetzt, die Menschen aus ihrer persönlichen Verantwortung entlassen zu wollen.
Doch das Gegenteil ist der Fall: Erst wenn wir die strukturellen Ursachen anerkennen, können wir Verantwortung sinnvoll und gerecht verorten. Wer immer nur auf das Individuum zeigt, schützt nicht die Selbstwirksamkeit. Er oder sie verschleiert die Machtverhältnisse.
Hier liegt ein zentrales Missverständnis, dem wir aktiv entgegenwirken müssen:
Wer systemisch denkt, entlässt niemanden aus der Verantwortung, sondern verortet sie dort, wo sie tatsächlich wirksam werden kann. Systemkritik ist nicht Resignation, sondern die Voraussetzung für kollektives Handeln.
Wer reflexartig im Rahmen des Persönlichen denkt, verliert den Blick für das Politische, und wer meint, systemische Kritik sei ohnehin wirkungslos, hat den Kern der Kritik verfehlt. Es geht nicht darum, dass wir nichts tun können, sondern darum, dass wir das Entscheidende nicht allein tun können. So sehr wir uns auch anstrengen und selber optimieren.
Der Irrtum vom mächtigen Individuum
Dieser Irrtum betrifft aber nicht nur die Ohnmächtigen. Auch die sogenannten „Mächtigen“ – Führungskräfte, Politiker:innen, Entscheidungsträger:innen – sind in dieses Spiel verstrickt. Ihnen sagt man: Veränderung beginnt mit dir. Du musst nur wollen. Du hast die Macht. Jetzt nutze sie.
Doch auch das ist eine Erzählung, die strukturelle Trägheit mit moralischem Druck überdeckt. Es gibt sie in Wahrheit nicht, die einsamen Entscheider:innen, die aus freien Stücken das System wenden könnten, selbst wenn sie wollten. Auch sie sind eingebettet in Verfahren, Regeln, Abhängigkeiten, Narrative. Auch sie sind Teil des Problems, nicht weil sie individuell versagen, sondern weil sie in strukturellen Zusammenhängen agieren, die Veränderung systematisch behindern.
Das heisst nicht, dass niemand Verantwortung trägt. Es heisst nur:
Wir müssen aufhören, die Verantwortung individuell zu denken und anfangen, sie systemisch zu verstehen. Sonst bleiben wir im Mythos des ermächtigten Einzelnen gefangen, jenem Trugbild, das uns glauben macht, Veränderung sei in erster Linie eine Frage des persönlichen Wollens, der Disziplin oder der inneren Haltung.
In Wirklichkeit dient dieses Narrativ dazu, systemische Machtverhältnisse zu verschleiern, indem es die Ursache für gesellschaftliche Missstände auf Einzelpersonen zurückspiegelt und so verhindert, dass wir gemeinsam beginnen, die Struktur des Problems zu verstehen.
Es ist an der Zeit, dass wir das benennen, was wir nicht benennen dürfen: Es sind nicht die Menschen, die die Verhältnisse verändern. Es sind die Verhältnisse, die Verhalten ermöglichen und verhindern. Kein Mensch ist per se resilient. Kein Kind ist von Natur aus lernschwach. Kein Jugendlicher ist zu wenig motiviert. Kein Erwachsener ist „schuld“ an seiner Überforderung.
Menschen sind Spiegel ihrer Möglichkeiten, und zugleich sind sie die Handschrift einer Ordnung, die sie nicht selbst entworfen haben. Der eigentliche Irrtum besteht also darin, Selbstverwirklichung für Unabhängigkeit zu halten und Verantwortung von den Verhältnissen zu entkoppeln.
Wieder und wieder starren wir auf Personen, auf Köpfe, auf Charaktere und nicht auf Strukturen, Prozesse, Dynamiken. Wir appellieren an Minister:innen, als könnten sie das System einfach umschalten. Wir erwarten von Führungskräften, sie mögen „mutig vorangehen“ als wäre das System nicht längst mit Sicherungen gegen Mut ausgestattet.
Natürlich haben sie Privilegien. Natürlich haben sie mehr Handlungsspielraum als andere. Aber auch sie sind – wie wir alle – von den Spielregeln geformt, die sie durchsetzen, weitertragen, absichern sollen. Wer also glaubt, Veränderung könne einfach durch „Entscheidungsstärke an der Spitze“ gelingen, erliegt demselben Irrtum wie ein Achtsamkeitspost für das erschöpfte Individuum: Er ersetzt Analyse durch Appell und Systemdenken durch Personalisierung.
Was wir jetzt brauchen: Den Perspektivwechsel vom Ich zum Wir
Wir brauchen keine Programme zur Selbststärkung. Wir brauchen Strukturen, die Menschen nicht vereinzeln, sondern verbinden; die nicht anpassen, sondern ermächtigen; die nicht fordern, sondern ermöglichen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.
Wir brauchen keine Coachings, die uns erklären, wie wir mit der Welt klarkommen. Wir brauchen Räume, in denen wir die Welt gemeinsam verändern können.
Bildung beginnt dort, wo wir nicht einfach fragen: „Was hält dich auf?“, sondern auch: „Warum gibt es diese Barrieren – und wem nützen sie?“ Denn Lernen heisst nicht, sich durchzubeissen, sondern gemeinsam die Bedingungen zu verändern, die Lernen behindern.
Wir brauchen eine Sprache, in der Kinder nicht „herausgefordert“ sind, sondern verstanden. Denn der Begriff Herausforderung verschiebt die Verantwortung stillschweigend zurück auf das Kind. Wer stattdessen versucht zu verstehen, fragt nicht, was am Kind schwierig ist, sondern was an den Bedingungen unhaltbar ist.
Wir brauchen eine Schule, in der Scheitern nicht stigmatisiert, sondern politisiert wird, weil Scheitern kein individuelles Versagen ist, sondern die Folge struktureller Schieflagen. Eine Schule, die das anerkennt, fragt nicht, wie das Kind sich ändern muss, sondern was das System lernen muss.
Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Macht nicht auf Einzelne projiziert wird, sondern als Systemstruktur erkannt und veränderbar gemacht wird.
Denn solange Macht personalisiert wird, bleibt sie unangreifbar. Erst wenn wir sie als Geflecht von Regeln, Rollen, Routinen begreifen, wird Veränderung möglich. Nicht durch Held:innen, sondern durch gemeinsame Arbeit an den Bedingungen.
Wir brauchen eine Welt, in der das Glück nicht als Lohn erscheint, sondern als kollektives Recht, denn Glück ist kein Wettbewerb und kein Verdienst. Es ist ein Ausdruck gelingender Beziehungen, gerechter Verhältnisse und geteilter Möglichkeiten. Glück sollte nicht die Belohnung für Anpassung sein, sondern der Ausgangspunkt solidarischer Zukunft.
Solange wir glauben, Veränderung beginne beim Willen Einzelner, wird sich eines gerade nicht verändern: die Welt.


