Schule funktioniert nach dem Prinzip Safari: vorgegebene Routen, pädagogische Konsumlogik, klar verteilte Rollen, Sicherheit durch Planung, standardisierte Erlebnisse, kontrollierbare Ergebnisse. Doch Lernen in einer Welt voller Unsicherheit braucht etwas anderes: Beteiligung statt Belehrung, gemeinsame Orientierung statt vorgezeichneter Wege. In diesem Blogpost habe ich eine Metapher ausgearbeitet, die mich seit Jahren begleitet, und die mir in meiner Arbeit als Bildungs- und Schulentwickler Orientierung gibt: Lernen als Expedition. Nicht nur Schule muss und wird sich in diese Richtung entwickeln. Auch Schulentwicklung ist heute Expedition – ein Aufbruch ins Offene, der alle Beteiligten in Bewegung bringt.
Die Unterscheidung zwischen Safari und Expedition trage ich schon sehr lange mit mir herum. Jetzt habe ich diesen grundsätzlich anderen Ansatz für Schule und Bildungsarbeit in die Form eines Blogpost gebracht – als weitere Etappe meines fortlaufenden Schreibprozesses mit KI.
Ein Bild gewinnt Kontur. Einführung in die Metapher
Stellen dir vor, du buchst eine Safari. Du weisst in etwa, was dich erwartet: spektakuläre Tiere, eine gut geplante Route, kompetente Guides, ein sicheres Fahrzeug, klare Etappen. Du bist nicht allein sondern Teil einer Gruppe. Deine Aufgabe: zu staunen, zu beobachten, zu geniessen – vielleicht ein bisschen zu fotografieren. Am Abend gibt es ein warmes Essen, ein Dach über dem Kopf, die Tagesroute ist geschafft. Das Abenteuer hat Struktur. Es ist berechenbar. Es ist sicher.
Stell dir nun eine Expedition vor. Niemand kann dir genau sagen, was dich erwartet. Es gibt Kartenfragmente, die stimmen vielleicht nicht. Du trägst den Proviant selbst. Es kann anstrengend werden. Es wird Zwischenstopps geben, vielleicht Rückschläge, Unsicherheiten. Aber es gibt auch Nähe, Beteiligung, Entscheidungsspielraum. Eine Expedition ist kein vorgefertigter Ablauf, den ich konsumiere – und sie ist keine „Schulreise“.
Sie wird durch das Tun und Denken der Beteiligten erst zur Expedition. Jede Perspektive verändert den Verlauf und ist deshalb wesentlich.
Eine Expedition ist kein Rundgang mit Erklärungstafeln. Sie entfaltet sich, weil Menschen aufmerksam mitgehen, Spuren lesen, Fragen stellen, Umwege riskieren. Ohne meine eigene Bewegung bleibt sie bloss eine Karte. Mit mir wird sie ein Weg.
Zwei Entscheidungen – zwei Haltungen
Wer eine Safari bucht, sucht bewusst oder unbewusst eine Mischung aus Sicherheit, Erlebnis und Überblick. Es geht darum, etwas zu sehen, etwas zu erleben, was andere vorher schon entdeckt haben; etwas zu geniessen, das vorbereitet wurde. Safari bedeutet mich führen lassen, mich beeindrucken lassen, auch mich berühren lassen, ohne selbst Teil einer Unsicherheit zu werden. Lernen heisst in diesem Modus beobachten, aufnehmen, verstehen, aber nicht selbst ins Offene gehen.
Wer sich auf eine Expedition begibt, folgt einem anderen Impuls. Hier geht es nicht nur um Neugier, sondern um Beteiligung. Nicht nur um Erleben, sondern um Verantwortung für das gesamte Projekt und sein Gelingen, angefangen von der Planung, der Organisation, der Durchführung und das Gelingen.
Ich will nicht wissen, was andere gesehen haben, ich will selbst entdecken, deuten, beitragen, Teil des Suchens werden. Lernen heisst hier: ausprobieren, irritiert sein, umdenken – gemeinsam mit anderen, nicht allein.
Die Expedition richtet sich an Menschen, die sich sagen: „Was ich suche, gibt es noch nicht – aber wir können es finden.“
Was passiert, wenn wir Schule durch dieses Bild neu sehen
Sowohl Safari als auch Expedition sind freiwillige Unternehmungen. Ich entscheide mich dafür. Aus Interesse, Abenteuerlust, Neugier.
Schule ist nicht freiwillig. Kinder entscheiden sich nicht, zur Schule zu gehen. Schule ist Pflicht. Insofern stehen alle Kinder und auch die meisten Jugendlichen nicht vor der Wahl zwischen Safari oder Expedition, und erst recht nicht für keines von beidem. Sie müssen mitgehen. Egal wohin.
Bei einer Safari oder Expedition im klassischen Sinn kann ich frei entscheiden: Ich überlege mir, was besser zu mir passt: Sicherheit oder Aufbruch, Struktur oder Suche. In der Schule ist das anders. Kinder haben keine Wahl. Deshalb gilt für mich:
Weil Schule durchgehend Pflichtveranstaltung für Kinder und Jugendliche ist, ist es so entscheidend, wie sie gestaltet ist: Nicht nur als Frage des Stils oder der Vorliebe, sondern als Frage einer alternativen Erfahrung:
- ob ich einfach „mitlaufe“, oder ob ich beteiligt bin
- ob ich durch ein Programm geführt werde, oder ob ich mitgestalte
- ob ich Antworten auswendig lerne, oder selber Fragen stellen kann
- ob ich bewertet werde, oder mit anderen zusammen etwas entwickle
- ob ich kontrolliert werde, oder Vertrauen erfahre
- ob ich mich anpassen muss („fitting in“), oder ob ich zeigen darf, wer ich bin („belonging to“)
- ob ich einfach mitfahre, oder selber mitgehe
- ob ich einer festen Route folge, oder mitentscheide, wohin wir abbiegen
- ob ich im sicheren Fahrzeug sitze, oder mit Proviant im Rucksack unterwegs bin
- ob ich erklärt bekomme, was andere entdeckt haben, oder selbst mit der Karte in der Hand unterwegs bin
- ob ich still beobachte, oder mit anderen bespreche, was wir gerade sehen
- ob ich ein Ziel erreiche, oder unterwegs auch lerne, warum wir überhaupt losgegangen sind
Schule als Safari nimmt die Unfreiwilligkeit ernst, indem sie Sicherheit herstellt: durch Pläne, Programme, Prüfungen, Fachlogiken, Bewertungssysteme.
Schule als Expedition nimmt Unfreiwilligkeit auch ernst, aber sie antwortet anders: Sie schafft Beteiligung. Sie macht das Gehen bedeutsam. Sie lädt ein zur Mitgestaltung. Sie verwandelt Pflicht in Möglichkeit, ohne zu verschleiern, dass der Weg auch anstrengend sein kann. „Expedition“ ist damit kein romantischer Gegenentwurf und auch nicht das Gegenteil von Schule, sondern eine Entscheidung, Lernen in der Schule stärker an der individuellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Wirklichkeit der beteiligten Menschen auszurichten – also an uns.
Warum diese Unterscheidung einen Unterschied macht
Die Welt, in der wir lernen und lehren, verändert sich nicht sprunghaft, aber spürbar. Das wird auch schon länger wissenschaftlich reflektiert.
Eltern und Gesellschaft erwarten zunehmend, dass Schulen nicht nur „Wissen vermitteln“, sondern dass es in der Schule auch um Kompetenzen wie Resilienz, Kreativität und digitale Souveränität geht. Ein umfassender Überblick über die Bedeutung von Persönlichkeitsbildung in Zeiten der Digitalisierung findet sich in dem Sammelband Persönlichkeitsbildung in Zeiten von Digitalisierung. Das Buch untersucht, wie Schulen auf die veränderten gesellschaftlichen Erwartungen reagieren können, indem sie neben fachlichem Wissen auch persönliche Kompetenzen fördern.
Ein Artikel, der die Auswirkungen der digitalen Realität auf das Lernen beleuchtet, ist dieser hier: Digitale Realität – Ein Weckruf für Lehrkräfte und Eltern. Er beschreibt, wie digitale Technologien die Lerngewohnheiten von Kindern verändern und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus für die Schule ergeben.
Traditionelle Vorstellungen von Bildung als linearer, jahrgangsbezogener Prozess werden durch die vielfältigen Lernwege von Kindern und Jugendlichen herausgefordert. Ökonomische Rahmenbedingungen verschieben sich: Nicht mehr nur Schulabschlüsse zählen, sondern Fähigkeiten, die sich in dynamischen Umfeldern bewähren. Flexibilität, Lernfähigkeit, Kooperation sind die „neuen Zeugnisse“, die nicht nur Arbeitgeber suchen, und zugleich sind es typische Fähigkeiten, die auf einer Expedition benötigt werden und entstehen.
Auch der Lehrplan 21 der Deutschschweiz legt einen starken Fokus auf überfachliche Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Lernbereitschaft. Diese Kompetenzen sind essenziell, damit sich Schülerinnen und Schüler in den Anforderungen der heutigen Lebens- und Arbeitswelt zurechtfinden: „Überfachliche Kompetenzen umfassen personale, soziale und methodische Kompetenzen. Sie sind für das Lernen in allen Fachbereichen bedeutsam und tragen dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler in der Gesellschaft und der Arbeitswelt bestehen können.“ (Quelle)
In der Optik der Safari-Schule sind das tatsächlich noch überfachliche Kompetenzen. In einer Expeditions-Schule sind es hingegen Kernkompetenzen im Sinne von Fähigkeiten, die in der modernen Lebens- und Arbeitswelt gefragt sind.
In der Safari Schule geben Lehr- und Unterrichtspläne die Route vor, die zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einem bestimmten Zeitraum von allen Lernenden abzufahren ist. Diese relative Stabilität der Prozesse und Abläufe deckt sich nicht mit der aktuellen Lebenswirklichkeit von Familien, Kindern und Jugendlichen, Lehrpersonen, von Gesellschaft und Arbeitswelt. Die Räume, die sich Jung und Alt lebenslang erschliessen, verändern sich mittlerweile so schnell, dass der Safari-Modus mit seinen Methoden längst an seine Grenzen gekommen ist.
Auch die Aussagekraft von Zeugnisnoten als zentrales Orientierungssignal für Bildungs- und Berufswege geht verloren, weil sie weder Teamfähigkeit noch Innovationskraft oder Reflexionsfähigkeit abbilden. Dieses Thema habe ich in einem eigenen Blogpost behandelt.
In dieser Situation genügt es nicht, Bildungsprozesse entlang festgelegter Pfade zu planen und durchzuführen wie eine Safari. Es braucht eine Haltung, die Beweglichkeit zulässt, ohne Halt zu verlieren, eine Haltung, die Orientierung nicht vorgibt, sondern gemeinsam entwickelt, die Unsicherheiten nicht ausklammert, sondern als Teil des Weges mitdenkt.
Einwand: Expedition überfordert Kinder
Ein oft zu hörender Einwand lautet: „Kinder können doch noch gar nicht wissen, wohin es gehen soll. Sie brauchen klare Vorgaben, nicht offene Prozesse.“
Diese Sorge führt schnell zu einer Ablehnung der Expeditionsidee aus Angst vor Überforderung, Chaos oder Verlust von Verantwortung: Wie soll Orientierung gemeinsam entwickelt werden mit Kindern, die das doch noch gar nicht können?
Die Frage berührt einen wunden Punkt in vielen Bildungsdebatten: Wir trauen Kindern weniger zu, als sie tatsächlich leisten können, vor allem wenn es um Mitverantwortung und Beteiligung geht. Dabei ist es ein fundamentaler Unterschied, ob Kinder wissen sollen, wohin es geht, oder ob sie lernen dürfen, wie sie sich orientieren. Bildung heisst ja nicht alles schon zu wissen. Bildung heisst lernen, mit Nicht-Wissen umzugehen. Das lerne ich auf einer Expedition, nicht auf einer Safari.
Kinder müssen auch gar nicht „die Richtung vorgeben“, und sie sollen auch nicht allein über Richtungen entscheiden. Es geht nicht darum, dass Kinder auf sich alleine gestellt Wege erfinden. Es geht bei der Expedition darum, dass sie erleben: Orientierung entsteht im Zusammenspiel, im Aushandeln, im Mitdenken. So erfahren Kinder, dass „Richtung“ (Entwicklung, Ziele, Etappen, Routen) nichts ist, was ich fertig übergestülpt bekomme, sondern etwas, das im Dialog entsteht: mit mir selbst, mit anderen, mit der Welt.
Wenn wir lernenden Menschen das vorenthalten, weil wir glauben, sie könnten es (noch) nicht, dann verpassen sie genau jene Erfahrungen, die sie brauchen, um in einer dynamischen Welt handlungsfähig zu werden. Das betrifft nicht nur Kinder.
Wir Menschen stellen Fragen. Wir sind irritiert, wir deuten. Als Kinder ebenso wie als Erwachsene. Wir tragen Entscheidungen mit, auch wenn wir sie nicht alleine treffen, und wir lernen, dass Verantwortung etwas ist, das geteilt werden kann. Das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich Menschen wünsche. Wer Kindern keine Mitverantwortung zumutet, verwechselt Fürsorge mit Entmündigung.
Expedition ist eine Zumutung – und ein Versprechen
Die Frage, ob Expedition oder Safari das passendere Bild für Bildung sei, ist keine didaktische Spielerei. Sie berührt den Kern unseres Bildungsverständnisses: Wie begleiten wir uns Menschen – ob jung oder alt – dabei, mit einer sich verändernden Welt in Beziehung zu treten?
Für Kinder ist Expedition das Natürlichste der Welt. Sie lernen durch Entdecken, durch Fragen, durch Irritation. Unsicherheiten schrecken sie selten. Vielmehr sind die ja Teil des Spiels, der Suche, des Wachsens.
Die eigentliche Zumutung betrifft nicht Kinder und Jugendliche. Sie gilt jenen Erwachsenen, die Schule bisher im Modus von Kontrolle, Planung und Steuerung erlebt haben und praktizieren: Lehrpersonen, Eltern, Bildungspolitiker:innen. Für sie bedeutet Expedition ein Loslassen von Sicherheiten, ein neues Selbstverständnis.
Der Safari-Modus bietet Lehrpersonen und Eltern Sicherheit durch Planung, Struktur und Vorwissen. Der Expeditions-Modus ermöglicht allen zusammen Entwicklung durch Beteiligung, Unsicherheit und gemeinsames Deuten. Beides hat seinen Platz. Aber wer Bildung als Zugehen auf eine offene Zukunft versteht, wird Expedition ernst nehmen, nicht als Methode, sondern als Haltung.
Gerade weil Schule für Kinder nicht freiwillig ist, muss sie ein Raum sein, in dem Menschen erfahren: Ich bin Teil dessen, was entsteht. Ich kann mich einbringen. Ich lerne mit Unsicherheit leben und mit anderen daraus etwas zu entwickeln.
Expedition ist kein Gegenmodell zur Schule. Sie ist eine Möglichkeit, Schule mit der gesamten Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Verbindung zu bringen.

Expedition als Bruch mit der Weltlogik von Schule
Diese Bewegung ist nicht technischer, sondern existenzieller Natur. Sie betrifft das Verhältnis zur eigenen Autorität, zu Unsicherheit, zu Verantwortung. Wer Expedition ernst meint, ist bereit, sich selbst als Teil des Geschehens zu verstehen, nicht nur als dessen Rahmengeber oder als Steuernde.
Noch einmal: Das traditionelle Bildungssystem funktioniert nach der Logik der Safari: Es gibt einen vorgezeichneten Pfad, klar definierte Ziele, fixierte Rollen. Diese Ordnung suggeriert Sicherheit. Sie basiert auf einem Weltbild, das Stabilität, Steuerbarkeit und Linearität voraussetzt. Doch dieses Konzept hat tiefe Risse bekommen, denn die Herausforderungen der Gegenwart folgen einer anderen Logik: Sie sind dynamisch, plural, widersprüchlich. Sie verlangen nach anderen Haltungen des Lernens.
Gesellschaftlicher Wandel
Gesellschaftlich erleben wir einen tiefgreifenden Wandel. Orientierung, wie wir sie kannten, verliert ihre Eindeutigkeit. In einer hochgradig fragmentierten, beschleunigten und pluralisierten Welt gibt es nicht mehr den einen richtigen Weg. Widersprüche, Werteverschiebungen und vielfältige Lebensentwürfe prägen unseren Alltag. Klassische Autoritäten und Orientierungssysteme haben an Wirksamkeit eingebüsst. Auch wenn sie hier und da wieder verstärkt Zustimmung erhalten, ist das nicht mit Wirksamkeit gleichzusetzen.
Gerade deshalb braucht es Lernräume, in denen Unsicherheit nicht als Defizit gilt, sondern als Ausgangspunkt. Expedition bedeutet hier: Geteilte Aufmerksamkeit. Dialogisches Entscheiden. Gemeinsame Sinnsuche. Nicht gegen die Unsicherheit, sondern mit ihr und miteinander.
Kultureller Wandel
Auch kulturell verändern sich die Grundlagen unseres Selbstverständnisses. Identität ist heute kein fester Besitz mehr, sondern ein andauernder Aushandlungsprozess. Menschen leben in multiplen Rollen und immer häufiger bereits in digital designten Öffentlichkeiten. Lernen als Expedition bietet hier nicht nur die Möglichkeit, etwas über die Welt zu lernen sondern auch über sich selbst. Wer gemeinsam aufbricht, teilt Verantwortung und Risiko, erlebt Irritation nicht als Scheitern, sondern als Beginn von Verstehen. Expedition schafft Räume für Selbstklärung (wer bin ich? was will ich mit meinem Leben? wohin möchte ich?) ohne Vereinzelung.
Technologischer Wandel
Die technologischen Umbrüche, insbesondere durch Künstliche Intelligenz, verstärken diese Dynamik. KI verändert das Verhältnis von Wissen und Nichtwissen grundlegend. Routinen lassen sich automatisieren, Verfahren und Urteile lassen sich simulieren. Was KI noch nicht kann: in unvorhersehbaren Situationen Orientierung generieren. Das wird zur neuen Kernkompetenz – und genau hier setzt Expedition an:
Expedition ist Training im Umgang mit dem Unvorhersehbaren anhand des Unvorhersehbaren.
Entscheidungen werden nicht antizipiert, sondern in der konkreten Situation verantwortet. Sicherheit entsteht nicht durch Vorwissen, sondern durch Beziehung, Reflexion und Zusammenarbeit im offenen Feld.
Ökonomischer Wandel
Auch die Ökonomie ist nicht länger geprägt von stabilen Berufsbildern oder klar definierten Karrieren. In dynamischen Kontexten verlieren abgeschlossene Kompetenzen an Wert. Gefragt ist nicht mehr, was ich weiss sondern wie ich lerne: wie ich mich mit eigenem und fremdem Nichtwissen bewege. Expedition ist dafür das passende Modell: Lernfähigkeit statt Wissensreproduktion, temporäre Orientierung statt fester Struktur, geteilte Verantwortung statt individueller Leistung.
Wer Expeditionserfahrung hat, bringt Urteilskraft mit, nicht nur angelerntes Wissen.
Pädagogische Konsequenz
Diese Veränderungen hinterfragen institutionelle Bildung grundsätzlich, auch wenn das von vielen Menschen, die mit Bildung zu tun haben, noch gar nicht so erlebt wird. Für Vertreter:innen des traditionellen Safari-Systems ist vielmehr klar: Sie setzen weiterhin auf Sicherheit durch Struktur, weil sie sich in ihrer Vorstellung von Bildung an Ordnung und Kontrolle orientieren; nicht aus Absicht, sondern aus biografischer Prägung und aus dem nachvollziehbaren Wunsch nach Orientierung, und nicht selten aus dem Bedürfnis, die eigene Unsicherheit zu regulieren.
Dieses Bedürfnis wird dann auf Kinder projiziert. Doch Kinder brauchen nicht mehr Struktur, sondern mehr Beziehung; nicht mehr Kontrolle, sondern Resonanz.
Die Frage, ob wir Bildung anders gestalten wollen, ist daher keine technische oder didaktische Herausforderung, sondern eine kulturelle und psychologische. Noch immer operieren Schulen nach dem Prinzip der Steuerbarkeit. Stoffpläne, Prüfungsformate, festgeschriebene Rollen geben vermeintlich Halt. Doch was damit in Wirklichkeit konserviert werden soll, ist ein heute untragbar gewordenes Bild von Bildung.
Expedition ist also auch in pädagogischer Hinsicht kein methodisches Extra. Sie drückt eine kulturelle Verschiebung aus nämlich: Auf einer Expedition lernen nicht nur die, die dazu verpflichtet sind, sondern alle, weil sie beteiligt sind. Lernen wird nicht delegiert, sondern geteilt. Kontrolle weicht Verantwortlichkeit.
Ungewissheit wird nicht eliminiert, sondern gemeinsam getragen. Wer Schule heute ernst nimmt, denkt sie als sozialen Raum, in dem das Nichtwissen nicht mehr als Ausnahme gilt, sondern als fortlaufender Ausgangspunkt.
Expedition bedeutet in diesem Sinn: Zumutbarkeit neu definieren und Bildung als gemeinsame Bewegung in eine ungewisse, aber gemeinsame Zukunft gestalten.
Expedition vs. Safari – eine systematische Gegenüberstellung
Um die beschriebenen Unterschiede zwischen Expedition und Safari konkret fassbar zu machen, folgt jetzt eine vergleichende Gegenüberstellung zentraler Dimensionen. Sie verdeutlicht nicht nur zwei unterschiedliche pädagogische Haltungen, sondern auch zwei konkurrierende Logiken im Umgang mit Bildung, Beziehung und Verantwortung.
| Aspekt | Safari | Expedition |
|---|---|---|
| Was haben wir vor? | Erkunden eines vorstrukturierten, bekannten Feldes | Gemeinsames Annähern an ein unbekanntes Feld |
| Zielverständnis | Ziel ist klar definiert und methodisch erschliessbar | Ziel wird unterwegs überprüft und angepasst |
| Gestalten der Bewegung | Ablauf ist vorgeplant (Route, Zeitplan) | Verlauf entwickelt sich prozesshaft im Dialog |
| Rollenverteilung | Feste Rollen: Führende vs. Geführte | Verantwortung ist geteilt, Rollen entstehen situativ („Soziokratie“) |
| Verhältnis zu Autorität | Vertrauen basiert auf Vorwissen der Führenden | Vertrauen entsteht durch Beziehung und gemeinsames Gehen |
| Umgang mit Ungewissheit | Ungewissheit wird minimiert oder kompensiert | Ungewissheit wird erwartet und produktiv genutzt |
| Umgang mit Fehlern | Fehler gelten als Abweichung | Fehler gelten als Schlüsselmomente des Lernprozesses |
| Dynamik und Steuerung | Bewegung wird durch Planung kontrolliert | Bewegung entsteht aus kollektiven Entscheidungen |
| Sicherheit | Sicherheit durch Struktur und Kontrolle | Sicherheit durch Beziehung und geteilte Erfahrung |
| Entscheidungslogik | Entscheidungen sind vorab getroffen und im Kern nicht verhandelbar | Entscheidungen entstehen unterwegs im Dialog |
Diese Tabelle ist kein Bewertungsraster im klassischen Sinn. Sie verdeutlicht, wie tiefgreifend sich die jeweilige Haltung auf das Lernen, das Lehren und auf das Zusammenleben auswirkt. Das Mindset „Expedition“ fordert mich auf, nicht nur neue Methoden zu denken sondern neue Beziehungen, neue Rollen und eine neue Logik von Bildung.
Wenn Begleiten nicht reicht: Expedition als gemeinsame Bewegung
Ein blinder bzw. weisser Fleck in der Diskussion um Schul- und Bildungsentwicklung ist die Rolle der Begleitenden selbst. Ein pädagogisches Programm und Konzept kann ja durchaus zur Expedition aufrufen, während Lehrer:innen, Coaches, Schulentwickler:innen oder Weiterbildende in sicherer Distanz zum Prozess bleiben. Sie sprechen vom Aufbruch, organisieren womöglich partizipative Prozesse. Selber bleiben sie jedoch in einer Rolle, die nicht mitgeht.
Diese Form von Begleitung ist durch gute Absicht motiviert, doch sie bleibt im Modus der Beobachtung, der Steuerung, der Absicherung. Sie ist Teil des Safari-Systems, selbst wenn sie sprachlich an Expedition anschliesst. Denn wer Expedition ernst meint, bewegt sich selbst mit. Auf Schule hin gesprochen beginnt Expedition also nicht beim Kind, sondern bei den Erwachsenen, die sie durch konsequentes Mitgehen ermöglichen.
Berufe der Schule sehen sich dann vor grundlegende Fragen gestellt:
- Was heisst es für mich, nicht nur zu begleiten, sondern mitzugehen?
- Wie verlasse ich meine vertraute Rolle als Planende, Erklärende, Kontrollierende, ohne meine Wirksamkeit zu verlieren?
- Was verliere ich, und was gewinne ich, wenn ich mich auf Ungewissheit einlasse?
Expedition ist kein Abenteuerformat für Schüler:innen. Sie ist eine Haltung, die alle betrifft. Sie verlangt, dass wir als Erwachsene und als Professionelle bereit sind, unser eigenes Verhältnis zu Kontrolle, Nichtwissen und Beziehung neu zu justieren. Wer Expedition nur organisiert, sie aber selbst nicht selbst wagt, bleibt im Safari-Modus – auch mit den besten pädagogischen Absichten.
Die grösste Herausforderung liegt daher nicht in der Entwicklung neuer Methoden, sondern im Loslassen alter Selbstbilder
- des Experten, der weiss, was richtig ist
- der Lehrerin, die den Plan hat
- des Schulleiters, der Orientierung vorgibt
Expedition bedeutet, das eigene Nichtwissen nicht zu verstecken, sondern es als Teil des Lernprozesses sichtbar zu machen. Es bedeutet, sich als Teil eines kollektiven Wagnisses genannt „Lernen“ zu begreifen, nicht als dessen Moderator. Das ist zu Beginn unbequem, und es macht dauerhaft verletzlich. Dadurch schafft es Räume für Resonanz, Mitgestaltung und echte Veränderung.
In diesem Sinn ist Expedition eine professionelle Zumutung, und sie ist zugleich ein Versprechen auf wirkliche Entwicklung in Beziehung.

Expedition als Veränderung des Selbstbilds
Lässt sich „Expedition“ als Haltung im Sinne einer Massnahme einführen?
Im Normalfall verbinden wir mit Schulentwicklung die Einführung neuer Formate, Methoden oder Strukturen. Doch im Kontext von Expedition erreicht keine Massnahme eine nachhaltige Wirkung, solange sich das Selbstverständnis der Beteiligten nicht weiterentwickelt.
Expedition beginnt nicht mit einem Konzeptpapier, sie beginnt im inneren Vollzug. Dort, wo Erwachsene nicht nur neue Wege organisieren, sondern sich selbst infrage stellen (lassen).
Diese Bewegung ist leise. Sie zeigt sich nicht in Tools, sondern in einem veränderten zur eigenen Rolle, zum Lernen. Nicht das theoretische Bekenntnis zu Offenheit ist entscheidend, sondern die eigene Rolle, Autorität und die eigenen Kontrollbedürfnisse konkret zu hinterfragen – erst recht dann, wenn sie sich stattdessen hinter gut gemeinten pädagogischen Haltungen verbergen könnten. Es bedeutet Prozesse auszuhalten, die ich nicht kontrollieren kann sondern mitgestalten.
Diese Veränderungen des Selbstbilds lassen sich exemplarisch an der Rollenbeschreibung von Lehrpersonen zeigen, je nachdem, ob sie sich im Safari- oder Expeditionsmodus bewegen:
| Rollenverständnis | Safari | Expedition |
|---|---|---|
| Selbstverständnis | Wissensvermittler:in, Planende:r, Kontrollierende:r | Lernbegleiter:in, Mitforschende:r, Ko-Konstrukteur:in |
| Beziehung zu Schüler:innen | Hierarchisch, instruktiv | Dialogisch, auf Augenhöhe |
| Umgang mit Fehlern | Fehler als Störung, die vermieden bzw. behoben werden soll | Fehler als Schlüsselmomente und „Entdeckungen“ im Lernprozess |
| Haltung zur Ungewissheit | Wird reduziert oder ausgeblendet | Wird zugelassen und geteilt |
| Ziel von Unterricht | Stoffvermittlung, Planerfüllung | Erkenntnisgewinn, gemeinsame Orientierung |
Wenn Strukturen offen sind und Menschen noch zögern
So klar das Bild der Expedition auch scheint, so anspruchsvoll ist seine Umsetzung, denn Expedition ist kein reformpädagogisches Stilmittel und keine methodische Variante von Innovation. Sie ist eine strukturelle Herausforderung für Institutionen und für alle, die in ihnen Verantwortung tragen.
Solange Schulentwicklung als Optimierung bestehender Abläufe verstanden wird, bleibt der Handlungsspielraum eng. Expedition hingegen verlangt einen Perspektivwechsel: weg vom Planen, hin zum Gestalten; weg vom Sichern, hin zum Aushalten; weg vom Wissensvorsprung, hin zur gemeinsamen Orientierung.
Genau hier liegt die grosse Herausforderung. Expedition ist institutionell zwar denkbar aber individuell aus dem traditionalen Selbstverständnis von Lehren und Lernen heraus nur schwer vorstellbar.
Lehrpersonen, Schulleitungen und andere Bildungsverantwortliche bewegen sich in hochregulierten Feldern, in denen Unsicherheit eher als Problem denn als Ressource gelesen wird. Der Mut, nicht zu wissen, wird selten belohnt. Die Bereitschaft, Kontrolle zu teilen, oft als Schwäche ausgelegt.
Deshalb braucht Expedition Räume, in denen Nichtwissen geteilt wird; in denen Lernen nicht bloss einseitig beobachtet wird, sondern mitvollzogen; wo Erwachsene nicht nur begleiten, sondern teilnehmen und teilgeben. Wo diese Räume entstehen, löst sich das Bild von der Expedition ein; nicht als Metapher, sondern als neue Wirklichkeit von Bildungsarbeit.

Was Schule möglich macht, wenn sie anders denkt, oder: Expedition braucht Räume und Entscheidungen
Expedition kann nicht verordnet werden. Sie braucht Bedingungen, unter denen sich Beteiligte überhaupt auf das Ungewisse einlassen können. Dazu gehören nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern vor allem physische, soziale und symbolische Räume, in denen Unsicherheit nicht sanktioniert, sondern zugelassen wird.
Solche Räume entstehen nicht durch Dekrete, sondern durch die Entscheidung
- Sicherheit nicht durch Kontrolle zu organisieren, sondern durch Beziehung
- nicht nur Ergebnisse zu beurteilen, sondern vor allem Prozesse
- nicht zuerst das System zu sichern, sondern die Menschen zu stärken, die es tragen.
Das ist keine romantische Idee. Es ist eine hochpolitische Frage: Wer bekommt Raum? Wer darf gestalten? Wer trägt das Risiko, und wer gibt den Ton an?
In traditionellen Schulsystemen sind diese Fragen klar geregelt.
Expedition hingegen beginnt dort, wo diese Ordnung durchlässig wird. Wo „zuständige Erwachsene“ Lernprozesse nicht vollständig kontrollieren müssen; wo Kinder nicht nur antworten, sondern eigene Fragen zum Ausgangspunkt des gemeinsamen Lernens machen, nicht, weil sie Antworten von Erwachsenen erwarten, sondern weil sie laut denken und den Raum dafür bekommen; wo Schulentwicklung nicht auf Programme reduziert wird, sondern Räume schafft für etwas, das noch nicht ist aber möglich werden soll.
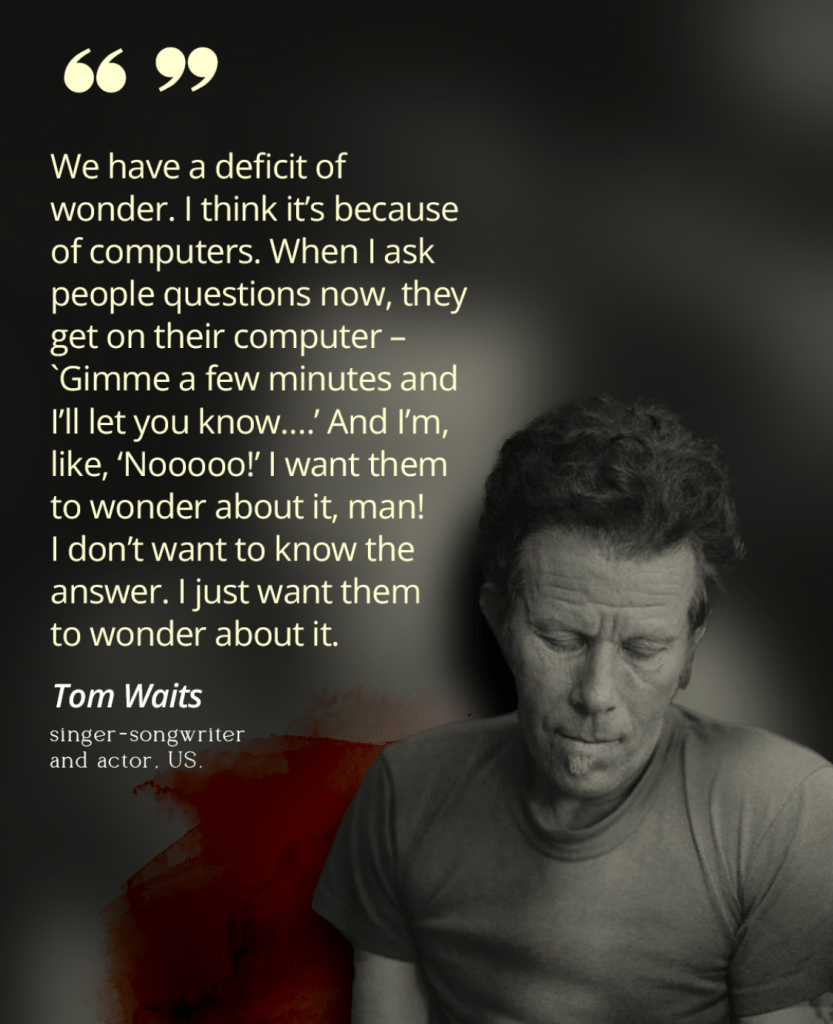
Expedition braucht Vertrauen und ein anderes Verständnis von Verantwortung
Expeditionen sind riskant. Nicht, weil sie leichtsinnig wären, sondern weil sie auf Kontrolle verzichten. In schulischen Kontexten ist genau das eine Zumutung: Wer Verantwortung trägt, will absichern, will wissen, wohin der Weg führt, und wofür er oder sie später zur Rechenschaft gezogen wird.
Doch Expedition fordert ein anderes Verständnis von Verantwortung: nicht als Garantie für Ergebnisse, sondern als Bereitschaft, sich in echte Prozesse zu begeben: gemeinsam, sichtbar, verletzlich. Verantwortung bedeutet hier nicht, alles im Griff zu haben, sondern präsent zu sein, sich ansprechbar zu machen, wenn etwas nicht gelingt, Entscheidungen nicht im Voraus abzusichern, sondern sie gemeinsam auszuhandeln, und nicht zuletzt auch den Mut zu haben, Unfertiges stehen zu lassen, weil Entwicklung nicht vollständig steuerbar ist – aus systemischer Perspektive ist sie sogar komplett „unsteuerbar“.
Vertrauen ist dabei keine naive Hoffnung, dass „alles gut wird“. Es ist eine professionelle Haltung: Ich traue mir und den anderen zu, dass wir den Weg gemeinsam gestalten können ohne ihn vollständig zu kennen. Solche Verantwortung entsteht nicht durch Hierarchie, sondern durch eine gleichwürdige Form der Beziehung, und solches Vertrauen entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch Resonanz. Im Modus der Expedition sind beide untrennbar verbunden: Vertrauen in die Menschen und die Verantwortung, den Raum offen zu halten, in dem sich etwas entwickeln kann.
Was dieses neue Verständnis von Verantwortung konkret bedeutet, lässt sich in der folgenden Gegenüberstellung verdeutlichen:
| Verantwortung als … | Traditionelle Schule | Expedition |
|---|---|---|
| … Definition | Ergebnisverantwortung | Prozessverantwortung |
| … Rolle der Erwachsenen | Absicherung, Kontrolle | Präsenz, Beziehung, Mitgehen |
| … Umgang mit Scheitern | Vermeidung, Sanktionierung | Reflexion, gemeinsame Neuorientierung |
| … Strukturprinzip | Hierarchie, Planung | Resonanz, Aushandlung |
| … Beziehung zur Zukunft | Planungssicherheit | Offenheit für Emergenz |
Expedition ist keine Methode sondern eine Frage an das System
Erste Ansätze, Schule partizipativ zu gestalten (etwa im Rahmen der von UNICEF Schweiz entwickelten partizipativen Schule), zeigen: systemische Öffnung ist möglich. Kinder erhalten Mitspracherechte, werden in Entscheidungsprozesse eingebunden und erleben Schule als gestaltbaren Ort.
Doch das Mindset der Expedition geht darüber hinaus. Es zielt nicht nur auf institutionelle Beteiligung, sondern auf eine gemeinsame Suchbewegung aller Beteiligten. Nicht nur Kinder werden gehört, auch Erwachsene verlassen ihre sicheren Rollen. Wo partizipative Schule Strukturen demokratisiert, verlangt Expedition eine Kultur der wechselseitigen Verunsicherung – nicht zum Zweck der Destabilisierung, sondern um Lernen als gemeinsamen Möglichkeitsraum zu eröffnen.
Das Mindset der Expedition verändert die Mechanismen, durch die Bildung organisiert wird und stellt Machtverhältnisse in Frage. Nicht ideologisch, sondern strukturell. Nicht gegen das System, sondern aus der Erkenntnis, dass Systeme nur dann resilient sind, wenn sie lernfähig bleiben. Das heisst:
Expedition kann nicht als Projekt organisiert werden, das irgendwann abgeschlossen ist. Sie ist eine Haltung, die fortwährend Spannungen erzeugt zwischen Sicherheit und Offenheit, zwischen Steuerung und Vertrauen, zwischen Kontrolle und Beziehung.
Schulen, die sich auf diesen Weg einlassen, erleben keinen sanften Wandel, sondern eine tektonische Bewegung. Nicht weil sie scheitern, sondern weil sie ernst machen mit der Idee, dass Lernen nicht planbar ist, und dass Bildung nicht reproduzieren soll, sondern hervorbringen.
Expedition bedeutet in diesem Sinne, dass wir das System Schule als lernende Organisation denken, nicht als Maschine, sondern als lebendiges, irritierbares, widerständiges Gefüge. Nur so kann es gelingen, aus der Metapher der Expedition eine reale Praxis zu machen.

Expedition beginnt mit Kultur, und sie verändert Institution
Viele Reformprojekte starten mit Konzeptpapieren, Leitbildern und Strategien. Expedition lässt sich jedoch nicht verordnen. Sie entsteht nicht auf dem Papier, sondern in der gelebten Kultur einer Schule, in der Art, wie Menschen miteinander umgehen, wie Abweichungen wahrgenommen werden, ob Unsicherheit zugelassen wird.
Kultur zeigt sich im Alltag, besonders dann, wenn niemand hinsieht. In Routinen, in Sprache, im Umgang mit Fehlern. Im stillschweigenden Bild von Lernen und Lehren entscheidet sich, ob Expedition möglich ist.
Jede Expedition ist deshalb auch ein Kulturprozess. Sie verändert, wie wir handeln, wie wir miteinander sprechen, wie wir Pläne machen, wie wir zuhören. Erwartungen wandeln sich, und es entstehen neue Möglichkeitsräume.
Wer Expedition ermöglichen will, braucht kein neues Programm. Vielmehr braucht es die Bereitschaft, Kultur zum Thema zu machen: gemeinsam, ehrlich, auch unbequem. Kultur lässt sich nicht einführen, sie lässt sich gestalten: durch kleine Entscheidungen, symbolische Akte und durch eine Führung, die mittendrin wirkt statt von oben herab.
Schulentwicklung mit Blick auf die Idee der Expedition bedeutet nicht, einen Plan umzusetzen. Sie ist ein Aushandlungsprozess auf Augenhöhe.
Sie entsteht nicht durch Programme oder Strukturen. Sie entsteht dort, wo auch die Erwachsenen bereit sind, sich selbst in Bewegung zu bringen, nicht nur zu steuern, zu begleiten oder zu gestalten, sondern sich irritieren zu lassen, mitzugehen, sich einzulassen.
Das ist womöglich der schwerste Schritt. Nicht, weil es an Konzepten fehlt, sondern weil es Unsicherheit erzeugt. Viele Beteiligte im System Schule sind geübt darin, Orientierung zu geben, aber weniger darin, sie gemeinsam zu suchen.
Doch genau darin liegt der Unterschied zur Safari: Expedition nicht als Methode, sondern als gemeinsamer Vollzug.
Wer dabei mitmacht, gewinnt ein geteiltes Verständnis von Verantwortung, ein anderes Verhältnis zu Wissen und die Möglichkeit, Schule nicht länger nur zu organisieren, sondern als lebendigen Raum für Entwicklung zu erfahren.
Auch und immer für die eigene.


